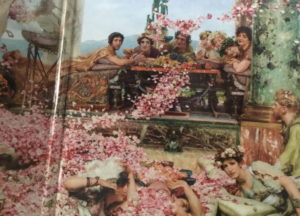Ab und zu erscheinen solche Alben wie aus dem Nichts. Vielleicht werden im Vorfeld bestimmte Schubladen bedient oder geöffnet: „Neue Musik“, Elektroakustische Musik, „imaginary soundtracks“ – und man macht sich ein Bild von dem, was auf einen zukommen könnte, bevor man einen Klang gehört hat. Oder man hört ein paar kurze Sequenzen und macht sich ein weiteres Bild von dem, was man da gerade auffängt, bevor man sich auf die Erfahrung des Lauschens eingelassen hat. Das „Reinhören“ ist bloss eine Umschreibung für rasche Einordnungen und reduzierte sinnliche Erfahrung. Kurz reinhören geht hier gar nicht – Verweilen ist das Zauberwort.
Am Ende der CD (im November wird auch die Vinyl-Ausgabe erscheinen) treibt sich, in der zehnten Komposition, ein gewisser Loplop im Wald herum. Kennen sie Loplop? Ich bislang nicht. Auch nicht jene Bilder von Max Ernst, in denen er dunkle Wälder auf die Leinwand bannte, die menschliche Wesen besser nicht aufsuchen sollten. Allein dem magischen Vogel Loplop gelangen diese Streifzüge.
Und der Auftakt dieser zehn Exkursionen in rares, reales, surreales Terrain trägt den Titel „This Town Will Burn Before Dawn“. Als das Stück erste Gestalten annahm, schwebte dem Komponisten, als dessen Instrumente „electronics & sampling“ gelistet sind, eine pulsierende, leuchtende Stadt voller Erfindungen vor, die von Barbaren niedergebrannt wird, ohne aber letzte Spuren der Hoffnung zu vernichten
Und dann das: man hört ja ab und zu etwas von Kometen, die sich unserem Planeten nähern. Wie ich aus einer kurzen Werknotiz erfahre, näherte sich vor Jahren ein Asteroid der Erde, der kurz vor dem Eintritt in unseren Orbit Halt machte, und in die umgekehrte Richtung davonzog. Selbst Wissenschaftler kamen zu keiner rundum einleuchtenden Erklärung, und so wurde das Internet überflutet mit Theorien, die natürlich auch extraterrestrisches Leben ins Spiel brachten. „Oumuamua, Space Wanderings“ ist der treffliche Name der Komposition eines Werkes, das sich thematisch anscheinend keinerlei Grenzen setzt.
Wir begegnen, wenn ich einzelne Titel als lockeren Leitfaden hernehme, unter anderem einer „kalten Front“, dem „Brief eines Verschwundenen“, einem Szenario „nach dem Sturm“. Der Autor lässt an anderer Stelle seiner Trauerarbeit angsichts des Todes eines Freundes so freien wie fokussierten Lauf. Eines scheint all diese asketisch angelegten Stücke zu durchdringen: das Gespür für Wandlungen, für Spuren von Licht in finstersten Zonen. Sowas kann leicht danebengehen, mit mollgetränkten Texturen, auffahrendem Pathos, schlicht gestrickter „New Age“-Requisite, und angestrengtem Grosskunst-Brimborium.
In keine dieser Fallen tappt Evgueni Alperine auf „Theory Of Becoming“, einem Album, das seinen fortlaufend überraschenden Kontrastierungen zum Trotz, jedem einzelnen Moment Raum und Tiefe gibt. Verzettelung ist ein Fremdwort für ein Werk, das sich, durchaus verführerisch Maske um Maske enthüllt, als dunkle Schwingung eines Kinderliedes, als verkappter Ohrwurm, als verlorene Partitur der Spätromantik, als Jules Verne-erprobte Weltraumfahrt, als Chronist realen Schreckens. „Theory of Becoming“ ist eine Art vollkommen klischeebefreiter Meditationsmusik. Und spannend geht es obendrein zu. Selbst da, wo die Klänge in Momenten denselbigen rauben, bleiben sie eine Schule des Atmens.
Es könnte ein neues Lieblingsalbum werden für Hörer, die die ureigenen Areale und Versunkenheiten von Steve Tibbetts „Life Of“ oder Arvo Pärts „Tabula Rasa“ schätzen, oder das Sololbum von Mark Hollis, wohl auch für solche, die gerne mal zu dem einen oder anderen Klassiker aus den Fundgruben von „Made To Measure“ und „Obscure Records“ zurückkehren, diesen historischen Labels und Spielwiesen für Undefiniertes von Marc Hollander und Brian Eno. Und sowieso trägt das Teil die Signatur „produced by Manfred Eicher“. Als etwas stillere Präsenz war gewiss auch der seltsame Vogel Loplop zugegen, in den Pariser Studios. Und der kennt die schnellen Wege, raus aus den Schutzzonen behüteter Hochkultur, und, wie aus dem Nichts, hinein in all unsere Wildnisse!