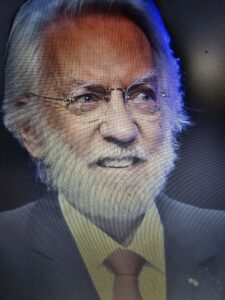Nein, ich habe die Fellinibiographie von Tullio Kezich nicht gelesen, nur die Rezension vom genial verschwurbelten Georg Seeßlen, und diese hat mich auch davon abgehalten es zu tun. Kezich war langjähriger Freund Fellinis und hat bereits zu seinen Lebzeiten 1987 den ersten Teil davon geschrieben. Einen grossen Teil dieses sicher sehr verdienstvollen, 2005 erschienenen Buches widmet der Autor offenbar der Rezipientenanalyse. Es gibt also Fellinianer (Leute die eine Rolle in seinem Leben spielten oder ihn in irgendeiner Form begleitet haben), die Fellinisanten (also wohl die Fans, wenn ich das richtig verstehe) und die Fellinisten (also Kritiker und Wissenschaftler) und Fellinologen, die noch irgendetwas anderes präferieren und repräsentieren … wurscht! Wird mir jetzt zu mühsam und ist nicht wirklich zielführend zum Verständnis, denn die Frage ist, ob es bei einer Würdigung eines Regisseurs notwendig ist, alle Splittergruppen in der Fanbase zu erforschen und wenn ich vor Beginn der Lektüre schon ein Vokabelheft anlegen muss, verzichte ich dann doch und mache mir lieber ein paar südlich-warme Gedanken über die langjährige tolle Beziehung zwischen dem Grande Maestro und mir. Er weiss leider nur nix davon, aber so ist das ja oft mit der Liebe.
Dann sehe ich den jungen Federico – in Amarcord Titto genannt (was für Assoziationen da wohl auftauchen mögen?) – der gerade an und unter der Brust der Tabakwarenhändlerin erstickt und das Ganze aber trotzdem phantastisch zu finden scheint, sehe Gradisca mit ihren Freundinnen beim ersten Schneefall durch Rimini stöckeln, Ascyltos und Encolpius sich um ihren Lustknaben streiten, Snaporaz durch ein Haus voller Feministinnen irrlichtern, eine gealterte Prostituierte, verfallend und trotzdem würdevoll wie eine Königin in ihrem Reich neben einem ebenso gealterten Bauwerk in Personalunion monumental an der Via Appia Antica stehen, das klerikale Defilee in Form einer Modenschau für pompöse Priestergewänder, der Aufmarsch der Damen in einem eher proletarisch-preiswerten Puff und andererseits einem für den gehobenen Anspruch in denen die Damen zum Posieren vor der Kundschaft mit den immergleichen Sprüchen – ob preiswert oder arriviert – ihre Fähigkeiten anpreisen. Und andere vergnügliche Bacchanale. Und die aufgebrezelte ältere Amerikanerin, die in Rom einem Touristenbus entsteigt, während in unmittelbarer Nähe schon die Gigolos lauern und eines dieser Testosteronpakete sich anpirscht, „Ju wonna pigscha?“ fragt und sie ihm neckisch posierend den Fotoapparat reicht. Sie bekommt ihr Pigscha und bestimmt noch einiges obendrauf – der Beginn einer kurzen, aber sicher wundervollen Freundschaft, bei der hoffentlich auch etwas für den Geldbeutel des schönen Römers herausspringt. Man gönnt es ihm, weil er mit seinem knallengen Shirt, dem Goldkettchen, dem grauenvollen Akzent des englischsprechenden Italieners und der unnachahmlichen Art die Sonnenbrille hochzuschieben und den ersten Feuerpfeil eines Blickes abzuschicken so herrlich dem Klischee entspricht. Dergleichen können nur Italiener, das brauchen andere Nationalitäten gar nicht erst zu üben.
Da menschelts gewaltig – wie kriegte der Maestro das bloss hin, dies alles nicht der Lächerlichkeit preiszugeben? Ausgenommen vielleicht den Priesteroutfit – Catwalk, aber der ist eher bizarr und gruselig – wenn man den Pomp der katholischen Kirche mitbedenkt, bleibt einem bei dergleichen ohnehin die Bolognese im Halse stecken. Aber Pigschas für die Ewigkeit in einer ewigen Stadt.
;
Was an Fellini vor allem besticht ist seine Körpernähe bzw seine Art, Körperlichkeit in Szene zu setzen und gleichzeitig die Darsteller zu schützen und nicht blosszustellen – sie bleiben bei jedweder Entstellung liebens – bzw achtenswert.
Mechthild Zeul beschreibt in ihrem Buch Das Höhlenhaus der Träume das Kino als eine Art Urhöhle, in der der Zuschauer mit Bildern, die er inhalieren darf, sozusagen gefüttert wird und in einem oral anmutenden Prozess mit dem Film verschmilzt, ihn aufnimmt und damit seine eigene Wirklichkeit in Form einer Synthese von Film und dadurch ausgelösten eigenen Vorstellungen und Empfindungen schafft, einen Übergangsraum zwischen Phantasie und Realität ähnlich wie Kinder es mit ihren Spielsachen erschaffen und eine Erklärung, warum jeder immer seinen eigenen Film sieht. Aufnehmen, Modifizieren, eine Art Stoffwechselvorgang …
Somit wäre ein Fellini-Film ein opulentes Festmahl, aus dem man satt wieder herauskommt. Trink Auge, was die Wimper hält … Gottfried Keller bleibt hier im Oralen und wäre sicher in späteren Zeiten auch Fellini-Fan geworden.
Die Welt von Fellini – so schreibt Seeßlen, ist ein Körper, der angesehen werden will, die Nebenwelten (Zirkus, Variete, Theater) öffnen und schliessen sich. Fellinis Blick auf die Welt, ihre Gesichter, Masken und Gesten „ist eine grosse Frechheit“. Das letzte ist von Seesslen sicher augenzwinkernd gemeint – der kindlich-freche Blick auf die Welt und ihre Eigenheiten, die als Verzerrungen anmuten und zur näheren Erforschung einladen.
Fellinis Filme künden auch noch von der Mythomanie Italiens und er zeichnet sie auch noch liebevoll in ihren Stadien des Zerfalls – vor allem die La Mamma Grande und ihrem vielversprechenden Körper, ihre Formen, ihre Begierden, ihre Gutartigkeit – mit dem Blick eines staunenden Kindes für das alles neu, interessant und rätselhaft ist und zur Dauererkundung einlädt – so sind seine Filme auch ein ständiges Unterwegssein zu immer gleichen und doch immer neuen Objekten die zur Erkundung einladen, so wie ein Kind den Körper der Mutter entdeckt und das Liebespaar den Körper des anderen und auf diesem Umwege dann auch wieder den eigenen. Das kindliche – und somit wertfreie – Staunen über die Schätze der Welt und die Begegnung mit ihnen ist in jeder Szene zu spüren und macht für mich den Reiz dieser Filme aus – dieses Angestecktwerden durch diese kindliche Sichtweise und das Erleben einer Welt ohne Bosheit und Niedertracht aber vom Zauber des Immer-Neuen kündend. Diese erschliesst sich ja nicht auf den ersten Blick sondern erst beim Beginn von Handlung und Kommunikation.
Und Hintern-Fetischist ist Fellini allemal, da gibts reichlich zu gucken für Gesinnungsgenossen, üppige Schönheit findet sich im Süden offenbar an jeder Ecke, das funktioniert bei ihm so zuverlässig, wie wenn man mit einem Leichenspürhund über den Friedhof geht.
Aber auch der Zerfall von Körperlichkeit ist sein Thema – die zerfallenden Statuen und Fresken im Untergrund von Rom, die von unserer Gegenwart vermutlich nichts mehr wissen wollen und sich lieber – und das im Wortsinne – bei Sauerstoffzufuhr verkrümeln; die Erben eines wohlhabenden Dichters, der per Testament verfügt hat, dass sie das Erbe nur erhalten, wenn sie seinen Leichnam verspeisen und denen wir beim wenig begeisterten und stark verlangsamten Kauen schadenfroh zusehen dürfen; die Protagonisten im Satyricon verwandeln sich am Ende in auf Felsen gemalte Bilder, verlieren also ihren Körper und bekommen gerade dadurch eine Form von überdauerndem Leben als ewiger, vom Zerfall geschützter Mythos. Gestaltwandel – auch das ein Teil des Lebens.
Und am Ende seiner Karriere noch ein grosser Treffer: Das kindliche Staunen von Ginger und Fred in Szene zu setzen und deren Stolz darüber im Alter noch einmal einen gemeinsamen Stepptanzauftritt vor grossem Publikum aufs Parkett legen zu dürfen – und nicht zu bemerken dass sie in einer Kuriositätenshow zynisch verbraten werden. Auch hier das Bewahren einer Unschuld die sich keine Ränkespiele vorstellen kann, vor allem das Gesicht von Giulietta Masina für sich allein könnte den ganzen Film bestreiten – staunend, erfreut, erschreckt, aber immer bodenständig und immer ein bisschen aus der Zeit gefallen innerhalb des Pandämoniums des modernen Showbusiness mit seinem Versteckte-Kamera -Blamagen-Humor. Mastroianni als Sahnehäubchen obendrauf als hinreissender und meistens angeschickerter alter Sack, der den Auftritt noch beinahe verstolpert und dabei doch seinen Charme bewahrt bzw den ihm stets innewohnenden Charme des Unperfekten wieder mal routiniert auf die Leinwand klatscht. Man könnte beide knuddeln und spürt doch schmerzlich den melancholischen Abgesang auf eine ganz andere versterbende Form der Kino- und Showkultur bei der es noch nichts blosszustellen und zu schämen gab.
Bei allem Inszenieren von Körperlichkeit hatte Fellini eine Ehefrau, bei der der Körper nur eine geringe Rolle spielte – Giulietta Masina pflegte ausschliesslich mit dem Gesicht zu arbeiten – eindrucksvoll erstmalig zu beobachten in La Strada als man dem abgestumpft wirkenden Landpomeränzchen mit Pokerface – Gelsomina – einen Hut aufsetzte und das Gesicht plötzlich eine Fülle von Affekten ausdrückte: Freude, Pfiffigkeit, Überraschung, Temperament, Neugier auf und Liebe zum Leben – sofort wieder in sich zusammenfallend bevor ihr grosser Zampano es sehen und vielleicht missbilligen hätte können.
Impact!
Aber der Zuschauer hat es gesehen und selten ist es einem Regisseur – und einer Schauspielerin – gelungen einen Menschen in Sekundenschnelle so komplett zu charakterisieren.
Und Fellini schaffte es aus seiner Schaffenskrise einen seiner grössten Erfolge zu konstruieren indem er genau diese zum Thema zu machte – Achteinhalb. Das muss man sich auch erst mal trauen und ist allemal besser als sich in einer narzisstischen Depression zu suhlen oder dramatisch zu erschiessen, weil man gerade mal nicht viel auf die Kette kriegt – als ob das Nicht – Künstlern nicht genauso ginge.
Wenn Morgenstern einen Fellini-Film gesehen hätte wäre er sicher aus dem Kino gekommen „selig lächelnd wie ein satter Säugling“.
Und darauf jetzt noch einen Grappa zum Verdauen und dann noch als dolci einen Film des Fellini-Schülers inhalieren, vielleicht Gente di Roma von Ettore Scola, der sich vom Stil des grossen Alten zu lösen verstand und eine neue ureigene Bildsprache mit einem ganz besonderen und unverwechselbaren Humor entwickelte. Das hätte dem Boss gefallen – diese kleinen short cuts ... die beiden Küchenhilfen – ein Römer und ein Afrikaner, die wüst miteinander streiten, sich wechselseitig als Idioten beschimpfen und anbrüllen, einer bereits zum Steakmesser greift und ein Blutbad mit zweifellos rassistischem Hintergrund in der Luft liegt, danach aber doch beschliessen Bier zu besorgen und sich abends das Spiel gemeinsam anzuschauen – als Freunde, aber leider Fans von zwei verschiedenen, konkurrierenden Fussballvereinen. (Jeder Bayer im ewigen Zwiespalt zwischen FC Bayern und TSV 1860 fühlt sich da sofort verstanden und erkannt). Dieses Spielen mit Erwartungshaltungen der Zuschauer und dem plötzlichen Kippen in eine andere Szenerie, in der plötzlich alles Gesehene eine völlig neue Bedeutung bekommt ist ureigenstes Markenzeichen von Scola. Keine grandiosen Pigschas, eher kleine hintersinnige Szenen eines genauen Beobachters des Lebens und seiner inhärenten und für den Könner leicht zu erkennenden und abzurufenden Komik. Darauf gleich noch einen Zweiten zum Wohle des Alten auf seiner Wolke am Himmel über der Cinecittà. Wo denn auch sonst?!
Arrivederci, Maestro und weiter gute Unterhaltung da oben mit Pasolini, Rossellini, Antonioni und Visconti und allen Vertretern des italienischen Neorealismus, die Dich gerne aus dem Olymp gestaubt hätten weil Du ihnen zu phantasievoll, verträumt und surreal und damit einfach nicht linientreu warst. Auch in der Kunst ist Gleichschritt erwünscht, nicht wahr? Gruss an alle cineastischen Betonköpfe und mach weiter Dein Ding!