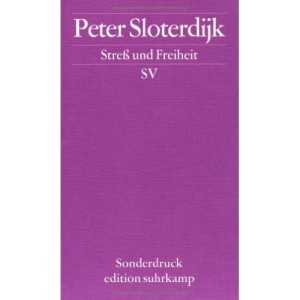Bevor nun der Reiter erneut sein schwarzes Roß sattelt und teufelsgleich einen altersgemäß kontrolliert ekstatischen Ritt in die Sommerlandschaft unternimmt – für den der geeignete, ihn begleitende Soundtrack vielleicht die Christopher-Cross-Songs Ride like the wind und Sailing wären oder das von Sting in Wildwestmanier gecoverte Hung my Head, das ja vom Leichtsinn singt, weil einer Rast macht und die Rifle ausprobiert, als Ziel seines Spiels aber fatalerweise eine Lebendattrappe wählt und somit fortan als Gehängter (el colgado) gilt – nimmt er die Gelegenheit wahr, falls er dann irgendwo auch am Galgen baumeln sollte oder an einem Schild für Vorfahrt, die er nicht gewähren wollte, seiner Nachwelt obenstehend ein seit längerem gewähltes Lieblingszitat quasi als Erbschaft zu übermitteln. Es entstammt dem Buch Logik der Sorge des Philosophen Bernhard Stiegler, der während seiner Inhaftierung aufgrund eines bewaffneten Banküberfalls in seiner Zelle zur Philosophie fand und inzwischen zu den bedeutenden zeitgenössischen Denkern Frankreichs zählt. Sein Buch mahnt den Verlust der Aufklärung durch Technik und digitale Medien an, einhergehend mit dem globalen Schwinden der Aufmerksamkeit und einer Infantilisierung der Gesellschaft, die beispielsweise Erziehungsberechtigte davon entbindet, Verantwortung und Vorbildfunktion zu übernehmen. Der vom Autor verwendete Begriff Retention fällt ins Auge: die Fähigkeit, in den gegenwärtigen Moment auch das (unmittelbar) Vorangegangene zu integrieren. Ein weiterer markanter Begriff: die Psychopharmaka – sie bezeichnen unter anderem fertige Kulturleistungen, die gar nicht mehr in ihrer geschichtlichen Entwicklung beziehungsweise Komplexität nachvollzogen, vielmehr ohne Respekt gegenüber Künstlern, Wissenschaftlern und Produzenten (per Mausklick) konsumiert werden. Was mich beeindruckt am Denken Stieglers, das sich zunächst schwer erschließt (die Franzosen, die spinnen, denkt man sich), sind seine Schärfe und Triftigkeit, die ja laut allgemeinem gesellschaftlichen Konsens in der Philosophie besser aufgehoben sind als in der Räuberei.