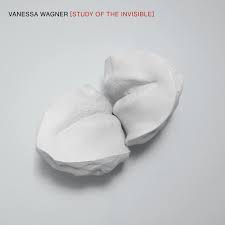Claudia Michelsen ist ein Hingucker, eine fabelhafte Schauspielerin, und wenn ich auch rein gar nichts über ihr privates Leben weiss, mutmasse und schlussfolgere ich aus allen äusseren Indizien, meinem Profilerwissen über Hüllen, Flächen und Tiefenstrukturen, dass sie in real life ein kluges Wesen von überdurchschnittlicher emotionaler und sonstiger Intelligenz ist. In diesem Fernsehfilm konnte sie nun alle Register ihrer Kunst ziehen, doch leider nicht mal damit über das gruselig überkonstruierte Drehbuch hinwegtäuschen: was für ein Schmarrn wurde denn da serviert!?
Claudia Michelsen spielt eine agile Sportlehrerin, die durch ein unbekanntes Trauma ihr enormes Schwimmtalent nie ausschöpfen konnte, und am Geburtstag ihrer völlig durch den Wind gebügelten Mutter von alten Symptomen befallen wird. Irgendwas zwischen Panikattacken, Halluzinationen und Absencen.
Claudia Michselsen besucht eine alte Lehrerin, die sie zur Therapie ermutigt, aber dagegen sträubt sie sich natürlich. „Was soll das denn bringen, in der Vergangenheit rumstochern?!“ Erst das Stöbern in den Schubladen ihres Vaters – sie stochert also doch rum, aber ohne Psychoanalytiker – lässt das Verdrängte mit Macht wiederkehren. Alles, was sich in diesen neunzig Minuten tut, ist eine Aneinanderreihung von Unwahrscheinlichkeiten, Klischees und Abstrusitäten. Der Gipfel ist die finale Sache mit einer Herzmuskelentzündung.
Wir haben noch den wirren Vater im Angebot, der sich mit humorvollen Versen a la Ringelnatz durch den Alltag hangelt, und irgendwann konfus durch eine Hannoveraner Stadtgegend irrt, und einen fremdvögelnden Ehemann, der, zur Rede gestellt, als erstes mault: „Wann verlierst du mal die Fassung, Anne?“ Durch die Bank krass überzeichnete Figuren. Und so mutiert alsbald der mutmassliche „Familienthriller“ zum Schnarchtheater mit unfreiwilligen Lachkick-Momenten. Zum Beispiel, als die Mutter mal wieder einer wirren Stimmung anheimfällt und ihr Kopf kopfüber auf den Tisch knallt (eigentlich noch lustiger, als wenn er in einen Erbseneintopf gefallen wäre) – im Krankenhaus erst klärt sich auf: kein „exitus subito“, sondern nur wieder zuviele Sedativa. Und dann das absolute Highlight:
Claudia Michelsen, also Anne, geht alte Videokassetten durch mit ihrem Finale zur Qualifikation der Olympischen Spiele von Atlanta. Sie sieht (wie wir nichts Gutes ahnenden Zuschauer) die Bilder, und hört die Stimme des Reporters, der sie als grösstes Talent feiert. Sie liegt vor der letzten Wende vorne, und dann, sehen wir alle dort nur noch Wasser und gähnende Leere, wo Claudia bislang ihre elanvollen Bahnen gezogen hatte. Der Reporter ist sprachlos, und fragt, sinngemäss: „Ja, was ist nun, wo ist Anne, wo ist sie denn, was ist passiert?“ Der perfekte „Jochen Behle-Moment“. Sie erinnern sich? Damals war der Reporter Bruno Moravetz, und er suchte verzweifelt Jochen Behle im Feld der langlaufenden Olympioniken.
Tatsächlich gibt es auch manch forsches Lob für dieses bemühte Melodrama. Ich zitiere Prisma:
„Was Michelsen, Hanczewski, Weisgerber und Co. im unprätentiös erzählten Drama ins Wohnzimmer liefern, dürfte manche an eigene dunkle Familienfeste, Offenbarungen und Eklats erinnern – oder, wenn daheim alles „paletti“ war, dann vielleicht an andere gute Filme zum Thema. Nicht zuletzt ist das bis zum Ende der 90 Minuten subtil spannende TV-Werk auch mal wieder ein Plädoyer in Richtung Fernsehmacher: Traut euch mehr Erzählungen ohne Leiche zu! Selbst erfahrene Primetime-Kommissarinnen freuen sich, wenn sie wie in diesem Film einfach mal nur leben – und nicht ermitteln müssen.“
Ehrlich jetzt?! „Einfach mal nur leben“ – der war gut!!