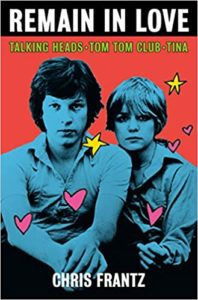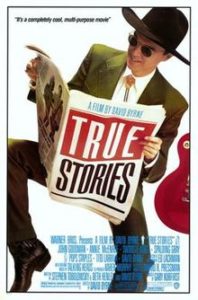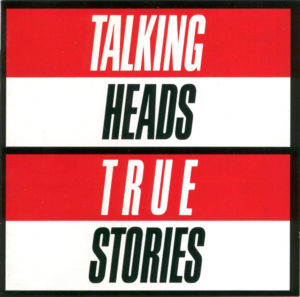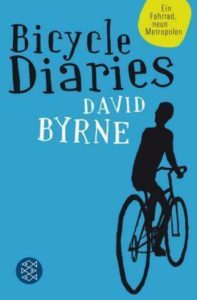Sicher wird niemand widersprechen, wenn ich sage, dass die Talking Heads eine der prägenden Bands der 1970er/80er Jahre gewesen sind. Noch heute haben ihre Platten kaum Staub angesetzt. Da sollte man annehmen, dass die Autobiographie eines ihrer Mitglieder eine interessante Lektüre sein müsste. Aber dieses Buch hinterlässt einen schalen Nachgeschmack.
Gut geschrieben ist das Buch. Entweder, Chris Frantz kann es tatsächlich, oder es war ein guter Editor am Werk. Wir erfahren allerlei aus Frantz‘ Jugend — das in Autobiographien Übliche. Schon dabei erweckt Frantz den latenten Eindruck, ein Dampfplauderer zu sein, aber darüber kann man zunächst noch hinwegsehen. Liest man, was er mit 15 bereits alles getan haben will, kann man das schmunzelnd glauben oder nicht. Liest man, wie er später zur Rhode Island School of Design (RISD) empfohlen wurde, könnte man meinen, hier sei der Welt ein neuer Warhol erschienen. Gut, dieses Institut gilt als Harvard des Kunststudiums. Was genau er dort gemacht hat, bleibt aber im Dunkeln. Statt dessen erfährt man alles über die Einrichtung seiner Studentenbude, wird mit den Namen von Kommilitonen zugenagelt und darf allerlei Histörchen über sich ergehen lassen, die wohl jedem vertraut sein dürften, der selbst mal eine Uni von innen gesehen hat. Und auch hier gilt wieder: Was man glauben möchte oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen. Immerhin lernt er Tina Weymouth kennen, und das ist eine bis heute andauernde Lovestory.
Das New York der 1970er Jahre, in dem die beiden dann landen, war ein hartes Pflaster, jedenfalls in den Gegenden, die für noch ziemlich mittellose Artschool-Absolventen in Frage kamen. In diesen Schilderungen ist das Buch wirklich interessant. In Hell’s Kitchen oder in Bowerynähe konnte man für 150 Dollar im Monat eine Fabriketage mieten. Die hatte üblicherweise weder Dusche noch Küche, dafür musste man sie mit Kakerlaken und anderen unwillkommenen Mitbewohnern teilen. Und am Abend stellte sich die Straße als belebter Straßenstrich heraus und die Zuhälter grüßten sich von einer Straßenseite zur anderen. Es dauerte eine Weile, bis sowohl sie als auch die Frauen begriffen hatten, dass Tina keine neue Konkurrenz war, sondern dort wohnte.
Dafür aber — und dafür beneide ich die beiden schon ein bisschen — waren dann das CBGB’s, Max’s Kansas City und Warhols Factory um die Ecke, Debbie Harry, Chris Stein und die Ramones wohnten in der Nachbarschaft, man konnte beim Krämer William S. Burroughs, Lou Reed, Patti Smith oder John Giorno über den Weg laufen. Wer New York auch nur ein bisschen kennt, weiß, wie diese Stadt jeden, der sich dort aufhält, unter Strom setzt. Alle diese Leute lernten sich schnell untereinander kennen und halfen sich mit Duschgelegenheiten und bei anderen Problemen aus. Geld hatten sie alle nicht viel, aber unglaubliche Mengen an Phantasie und Improvisationsvermögen. Das führte fast zwangsläufig dazu, dass neue Bands, Auftrittsmöglichkeiten, kleine Labels, einfache Studios und alle möglichen künstlerischen Projekte entstanden, wie sie nur hier entstehen konnten. Manche Leute, wie etwa Lou Reed, wurden dabei auch ziemlich tricky. Auch Patti Smith oder Mitglieder der Ramones kommen bei Frantz nicht besonders gut weg. In diesem Chaos jedenfalls hoben Chris, Tina und der inzwischen mit ihnen zusammenlebende David Byrne die Talking Heads aus der Taufe; lange Zeit als Trio, später gesellte sich ihnen Jerry Harrison von den Modern Lovers hinzu.
Dass sich Chris stets als quietschmunteres Rehlein darstellt, das unbeschwert durch die Welt hüpft, mag in Ordnung sein. Vielleicht ist er das ja wirklich. Dass er zwischendurch ein Koksproblem entwickelt, wird immerhin nicht verschwiegen. Zunehmend ärgerlich wird aber seine Masche, sich selbst und Tina als Unschuldsengel zu stilisieren, die immer alles richtig machen und die Verantwortung tragen, während alle anderen Beteiligten ständige Störfaktoren sind oder — wie Jerry Harrison — überhaupt nur am Rande vorkommen. Statt dessen hat Frantz die Namedropping-Krankheit. Und dabei geht es nicht um die an der Karriere der Band Beteiligten, sondern jeder Kneipenwirt, jeder Tourbusfahrer und jedes Zimmermädchen in jedem Hotel werden genannt. Bei der Hochzeit von Tina und Chris wird uns buchstäblich jeder Verwandte, jeder Freund und jeder sonstwie Beteiligte vorgestellt (und es sind große Familien!). Das Buch entwickelt sich von Kapitel zu Kapitel mehr zu einer nichtendenwollenden Aufzählung von Tourneestationen, Studiosessions und Partys, und was es dort zu essen gab. Typisch auch ein Kapitel, das in den Compass Point Studios auf den Bahamas spielt. Es trägt die Überschrift „James Brown“. An dessen Ende haben wir erfahren, dass er da war. Das ist alles.
Das zieht sich durch das Buch. Auf der einen Seite wird man mit banalen Details erschlagen, auf der anderen Seite werden ganze Jahre in der Karriere der Talking Heads auf einer halben Seite abgefeiert oder ganz übersprungen. Das Zustandekommen ihrer wichtigsten Alben (Fear of Music, Remain in Light, Speaking in Tongues) wird zu kurz abgehandelten Nebensachen.
Insbesondere hat sich Frantz auf David Byrne eingeschossen. Dem spricht er zwar sein Können nicht ab (das wäre lächerlich, das ist ihm klar), aber dessen Anteil am Erfolg und Auftreten der Band wird ständig heruntergespielt. An Byrnes Persönlichkeit lässt Frantz von der ersten bis zur letzten Seite kein gutes Haar. Mit Sicherheit hatte Byrne seine Macken. So hatte sich die Band etwa darauf geeinigt, alle Namen in alphabetischer Reihenfolge als Autoren der Songs auf der Platte zu nennen. Byrne hintertrieb das dadurch, dass er kurz vor Drucklegung des Covers die Credits in „David Byrne and Talking Heads“ ändern ließ. Das ist fraglos eine Frechheit, auch wenn sie finanziell niemanden benachteiligte. Die Beteiligung Brian Enos als Produzent und sein kreativer Input werden einerseits sehr positiv hervorgehoben (auch hier wäre alles andere lächerlich), gleichzeitig wird Eno aber dargestellt als jemand, der sich ständig in den Vordergrund zu stellen und im Bündnis mit David als Co-Komponist in die Credits zu schmuggeln versuchte. Unter gleichberechtigten Bandmitgliedern gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder, man klärt solche Unstimmigkeiten sofort an Ort und Stelle und macht klar, wo die rote Linie ist — oder man nimmt die Vorkommnisse hin, genießt das resultierende Bankkonto und hält den Mund. Sich aber 40 Jahre später hinzustellen und in einem Buch zu lamentieren, der Betreffende sei aber ein Arsch gewesen — das ist schlechter Stil.
Anderes Beispiel: Chris berichtet, wie Tina und er in irgendeinem Provinzkino Davids Film True Stories (an dem sie immerhin als Mitwirkende beteiligt waren) sahen. Er schreibt, wie angeblich die Zuschauer reihenweise gelangweilt den Saal verließen und am Ende er mit Tina allein im Kino saß. Auch hier gilt wieder: Man mag es glauben oder nicht. Aber man merkt die Absicht und ist verstimmt. In einem anderen Fall, den ich hier nicht ausführen will, wird David auf eine fast schon infame Weise ein unsägliches Verhalten dem Hotelpersonal gegenüber unterstellt und dann im Nachhinein gesagt, man wisse gar nicht, ob der Vorfall überhaupt von ihm ausgegangen sei oder von einem der Roadies. Und weil das noch nicht reicht, wird dem Leser an anderer Stelle zugetratscht, auf wie schäbige Weise sich David angeblich von seiner Frau getrennt habe. Selbst wenn es wirklich so gewesen sein sollte, wäre das eine Privatangelegenheit zwischen David und seiner Frau, und es steht Frantz nicht zu, sie in einem Buch in die Welt zu blasen.
Wie immer in solchen Fällen erfährt man mindestens so viel über den Kläger wie über den Beklagten.
Konsequenz: Schauen wir mal wieder, was David Byrne als Solokünstler gemacht hat, und vergleichen es mit dem, was man von Chris und Tina gehört hat. Da steht dann My Life in the Bush of Ghosts als eine der wichtigsten Platten der 1980er Jahre gegen den Tom Tom Club, der zwar zugegebenermaßen unterhaltsam ist, aber mehr wohl nicht. Klar, eine gute Band ist immer mehr als die Summe ihrer Mitglieder. Aber der Film Stop Making Sense zeigt noch immer unabweisbar, wer das Image der Talking Heads geprägt hat. Einem Menschen mit einigem Verstand — und das ist Chris Frantz — sollte es möglich sein, das zuzugeben.