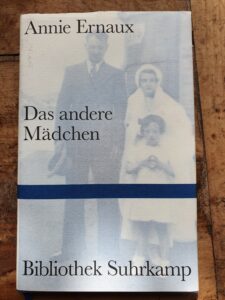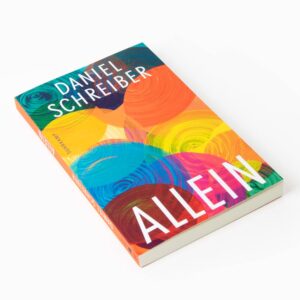zu Jean-Philippe Toussaint, „Das Badezimmer“, btb 2007 (Original: Paris 1985), 111 Seiten, aus dem Französischen und mit einem Nachwort von Joachim Unseld

Dem namenlosen Helden begegnen wir sogleich in der Badewanne: „Ich verlebte angenehme Stunden da“, heißt es, die Lebensgefährtin Edmondsson findet ihn „ausgeglichener“, die Mutter bringt Eclairs und schließlich kommt ein Brief von der österreichischen Botschaft, der wohl ein Irrtum sein müsse, befindet der Held, da er „weder Diplomaten noch Österreicher kenne“. Weil es aber „möglicherweise nicht sehr gesund (sei), im Alter von siebenundzwanzig, bald neunundzwanzig Jahren“ (ich lese mehrmals, aber es steht wirklich so da) „mehr oder weniger zurückgezogen in einer Badewanne zu leben“ müsse er „das Wagnis eingehen (…) die Seelenruhe (seines) abstrakten Lebens auf Spiel zu setzen“: Er verlässt die Badewanne.
In der übrigen Wohnung kann der Held aber nicht auf Ungestörtheit bauen: In der Küche harren zwei polnische Künstler aus, Edmondsson hat sie bestellt, um dort zu streichen, aber mangels Farbe (die Edmondsson offenbar nie vor hatte zu besorgen) häuten die beiden mitgebrachte Tintenfische.
Ein Umzug findet statt, aber es bleibt ungemütlich, ungeheizt, und es gibt nur einen einzigen warmen Pullover für den Helden und seine Freundin, der auch noch viel zu klein ist – dazu die Begegnung mit den Vormietern und auch der Besuch zur Wohnungs-Einweihung, die Toussaint in einer kühl-ironischen Haltung als eine Abfolge von Peinlich- und Zudringlichkeiten schildert.
So endet der erste von drei Teilen, das Buch ist in kürzere und längere, durchnummerierte Absätze gefasst. Zu Beginn des Mittelteils unternimmt der Held dann einen weiteren Versuch, seinen inneren Frieden wiederzufinden: „Ich war überstürzt aufgebrochen“.
Ich suche nach einem Hinweis, wohin die Reise führt – dieser zweite Abschnitt ist mit „die Hypotenuse“ betitelt – und reibe mir die Augen: Geht es hier um Mathematik? Um das Lösen einer komplexeren Aufgabe? Oder schlicht um die Sehnsucht nach der Emotionslosigkeit mathematischer Vorgänge – „einem abstrakten Leben“ – Meine Neugier und mein Spürsinn sind geweckt: Nach und nach stellt sich heraus, dass der Held nach Venedig gefahren ist, in ein Hotel, das Toussaint, als wollte er einen Museumsbesuch beschreiben, in karger Sprache als barocke Tableaus entfaltet. Was unser Held dort mit sich anfangen soll, bleibt ihm offenbar ebenso rätselhaft wie uns LeserInnen selbst, diesem Held, der sich schließlich im letzten Teil des Buches einer „Nebenhöhlenvereiterung im Anfangsstadium“ ergibt und in ein Krankenhaus reklamiert. Von wo aus er sich mit dem behandelnden Arzt anfreundet, der ihn zum Abendessen (Nieren) und Tennisspielen einlädt. Man könnte nun meinen, in diesem letzten Teil habe der Held seine Bestimmung gefunden, da er sich schon seit der Ankunft in Venedig nach einem Tennis-Match sehnt, so sehr, dass er sich unter anderem darüber mit seiner ihm nachgereisten Gefährten Edmondsson entzweit.
Edmondsson versucht, ihn dazu zu überreden, zu ihr nach Paris zurückzukehren – in ihrer Gegenwart profiliert sich unser scheuer Held am deutlichsten: Gegen ihre „ruhige Entschlossenheit“ kommt er nicht an, lässt sich von ihr durch die Stadt, die Museen, die Kirchen führen, statt dass sie mit ihm zum Tennisplatz käme, wo er sich doch schon in aller Früh, noch vor Öffnung des örtlichen Kaufhauses, um den Kauf von Bällen bemüht hat. Zum wiederholten Mal verführt sie ihn, und die auf der Bettdecke platzierte Schachtel fällt zu Boden: „alle Tennisbälle kullerten über das Parkett“, ein Sinnbild für den Helden, der immer wieder und bis zur Selbstverleugnung versucht, „ihr zu Gefallen zu sein“ – „Nein, sie hörte mir nicht zu“, heißt es wenig später, und: „Wir hatten uns alles gesagt, wir waren uns nicht einig. (…) Angesichts soviel bösen Willens blieb mir nichts mehr zu sagen: nein, ich sagte nichts mehr.“ Die Situation spitzt sich zu: Er bleibt auf dem Zimmer, tröstet sich mit einem Wurfspiel, im gleichen Kaufhaus erstanden, sie findet ihn „beklemmend“, bittet ihn aufzuhören: „Mit aller Kraft warf ich einen Pfeil, der in ihrer Stirn steckenblieb.“ Wenig später quält den Helden selbst „ein stechender Schmerz in der Stirn.“
Ist das wirklich so geschehen? Beim Lesen lässt mich das Gefühl nicht los, einem Tagtraum beizuwohnen, denn schließlich kehrt der Protagonist doch nach Paris zurück, in die Badewanne, in exakt gleichen Sätzen und Formulierungen, so dass man sich fragt: Hat er sie jemals verlassen?
Das schmale Bändchen hat mehrere Böden, Falltüren, durch die man von einer Symbolik zur nächster rutscht, wiederkehrend, von der Dame Blanche (Vanilleeis mit heißer Schokolade), die gleich zu Beginn auftaucht als „Kombination (…) der Vollkommenheit schlechthin“ bis zu Mondrian als Maler der „Bewegungslosigkeit“.
Ich staune angesichts der Bestimmtheit, mit der Toussaint seine Szenen entfaltet: Die Absurdität stört angesichts der subtil-eleganten Situationskomik kein bisschen, die geschilderten Unannehmlichkeiten erscheinen einem auf unheimliche Weise nur allzu bekannt: Hat man sie schon gehört? Irgendwo gelesen? Gar selbst erlebt und schnell im Gedächtnis vergraben?
Toussaint legt seinen Helden auf kein Gefühl fest – in welcher Bedrängnis er sich jedoch gerade befindet oder welche Neugier ihn umtreibt, erschließt sich geradezu natürlich, ergibt sich wie das Ergebnis einer Rechenaufgabe aus der Konstellation des Helden zu seiner Umgebung: Eine Mathematik des Hingeworfenseins? Ist hier auch das fehlende achtundzwanzigste Jahr „aufzufinden“, ein verbotenerweise ausgestrichenes Jahr, ein nach Möglichkeit verdrängtes?
Leidenschaft entfalten beim Helden Spiel und Sport: Intensiv fiebert er beim Fußballmatch zwischen Inter Mailand und den Glasgow Rangers mit, das im Aufenthaltsraum des Hotels per Fernsehen übertragen wird, hier entsteht menschliche Verbundenheit mit den Männern des Hotelpersonals. „Ich begann mich mit dem Barmann anzufreunden (…) Dass uns eine gemeinsame Sprache fehlte, entmutigte uns nicht“, die Unterhaltung besteht aus Kopfnicken im Treppenhaus und in der abwechselnden Nennung der Namen von Radrennfahrern: „Was zum Beispiel Radsport betrifft, waren wir nicht zu bremsen.“
Imponierend, wie es Toussaint gelingt, die Innenwelt des Helden anhand von äußeren Vorgängen darzustellen, die nüchtern-schnörkellose Erzählweise lädt die Fantasie der LeserIn ein. Kitzelt die Sehnsucht, sich ebenfalls mal „Urlaub vom Leben“ zu nehmen, wie Robert Musils „Mann ohne Eigenschaften“, auf den Toussaint ganz offensichtlich anspielt: Unser Held malt sich in einem lebhaften Tagtraum aus, den österreichischen Botschafter zu treffen, den der Autor ganz ohne Umschweife „Eigenschaften“ nennt.