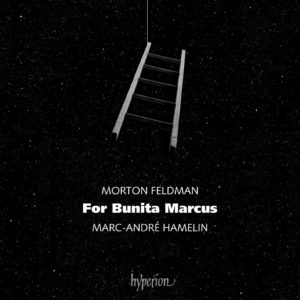Es muss so um 1973 gewesen sein. Da sendete das dezidiert kleingeschriebene ZDF-Kulturmagazin „aspekte“ einen Beitrag über Rockmusik aus Deutschland. Zum ersten Mal sah ich dort Tangerine Dream mit in ihrem Proberaum improvisierten langaushallenden Orgelakkorden, die wohl einer Farfisa und einer Vox entstammten. Das gefiel mir, und so erstand ich am darauffolgenden Tag bei Govi das Album Alpha Centauri von 1971 – an dem Tag das einzige, das sie dort hatten. Das gefiel mir auch sehr gut. Mehr aber auch nicht. Ich habe die Band dann nicht weiter verfolgt und die Platte auch selten wieder gehört.
Aber dann, wohl um 1975, da hörte ich nachts im NDR den xten Teil einer Serie über, ich glaube, David Bowie (wenn mich nicht alles täuscht, war die von Heinz-Rudolf Kunze und nicht mal schlecht, auch wenn er lange auf Bowies angeblichem Hitlergruß herumritt, den es so nie gab). Danach war noch reichlich Zeit bis zu den Mitternachtsnachrichten, und die wurde genutzt für „Ricochet Part 2“ von Tangerine Dreams aktuellem Album Ricochet – und was soll ich sagen: Das hatte mit der Gruppe von 1971 nichts mehr zu tun. Selten hat mich ein Musikstück unvorbereitet derartig aus den Socken gehauen wie dieses, und einen Tag später hatte ich alles, was Tangerine Dream bis dahin gemacht hatten.
Danach hatte ich dann eine ungefähr zwei Jahre anhaltende Phase, in der ich „normale“ Musik kaum noch ertragen konnte. (Ich muss darüber immer noch schmunzeln, weil die von mir geschätzte und leider viel zu früh verstorbene Ingeborg Schober mir irgendwann mal erzählte, dass es ihr ebenso ergangen war; bei ihr war der Auslöser allerdings Eberhard Schoener gewesen.) Tangerine Dream sah ich live zum vierten oder fünften, auf jeden Fall letzten Mal live im Jahr 1982 auf ihrer „Logos“-Tour, bis zu ihrem Hyperborea-Album habe ich die Plattenveröffentlichungen noch verfolgt, dann habe ich das Interesse verloren. Die Band hatte sich inzwischen auf Filmmusik spezialisiert, und die empfand ich im wesentlichen als akustische Auslegeware.
Und nun hat also Edgar Froese seine Autobiografie geschrieben. Jedenfalls steht das so auf dem Cover; ich bin mir nicht sicher, ob ich das Buch so bezeichnet hätte. Froese hat die Arbeit an diesem Buch nicht abschließen können, da er unglücklicherweise mittendrin, im Januar 2015, seine kosmische Adresse wechselte. Zwei Jahre haben die Subskribenten letztlich warten müssen – die von Froese abgeschlossenen Kapitel mussten sortiert werden, dann tauchte plötzlich eine Festplatte mit weiteren Kapitelentwürfen auf, die bearbeitet und eingefügt werden mussten, dann gab es Probleme mit der Übersetzung (das Buch ist parallel in identischer Aufmachung in deutscher und englischer Sprache erschienen), auch Fotorechte waren nicht in allen Fällen einfach zu bekommen, und so wurde der Erscheinungstermin ein ums andere Mal verschoben.
Nun kann man sich darüber freuen, dass das Buch doch noch erschienen ist, aber man wird das Gefühl nicht los, dass es nicht dem entspricht, was Froese wohl vorschwebte. Die Kapitel in Force Majeure sind zwar einigermaßen chronologisch von 1967 bis ungefähr 2014 geordnet, eine zusammenhängende Chronologie bilden sie aber nicht. Eher haben wir es mit einer Sammlung von Einzelepisoden, Histörchen und Anekdoten zu tun. Etliche davon sind schrecklich banal und machen einen, mit Verlaub, hingehauenen Eindruck; ich bin mir ziemlich sicher, dass sie von der später aufgetauchten Harddrive stammen und in dieser Form gar nicht zur Veröffentlichung vorgesehen waren.
Durch fast das ganze Buch zieht sich ein Hauch von Freudlosigkeit. Immer wieder laufen die Schilderungen ins Leere und verlieren sich in endlosen, geschraubten Formulierungen, die Froese wahrscheinlich für eloquent und unterhaltsam hält, die einem aber irgendwann nur noch auf die Nerven gehen. Konzerte und Tourneen scheinen eine einzige Anhäufung von Widrigkeiten gewesen zu sein, ausgelöst zumeist durch dämliche Veranstalter, Gewerkschaftsidioten, stupide Hausmeister und verstärkt noch durch begriffsstutzige Journalisten, denen Froese vermutlich nicht mal einen Bleistift anvertraut haben würde. Wenn er von seinen Mitstreitern, Freunden oder Verhandlungspartnern berichtet, oder auch von David Bowie, der eine kurze Zeit sogar in Froeses Wohnung lebte, gelingt es ihm nicht, sie in ihrem Wesenskern zu erfassen und nachvollziehbar darzustellen. Selbst belanglose Zwischenfälle werden stets bis ins Hysterische hochgedreht, und man fragt sich, wie überhaupt je ein Konzert heil über die Bühne gehen konnte.
Seinen Mitmusikern stellt Froese Beurteilungen aus, die sich wie Kopfnoten im Schulzeugnis lesen — oft fehlt nur noch „er hat sich stets bemüht, die ihm zugeteilten Aufgaben zu unserer Zufriedenheit zu erfüllen“. Die jedem Fan bekannten Spannungen zwischen Froese und Christoph Franke zeigen sich im Buch nur darin, dass Froese ihn durchweg als „Franke“ bezeichnet, während andere immerhin einen Vornamen haben. Worin die Spannungen aber nun bestanden, das bleibt im Dunkeln. Über Johannes Schmölling erfahren wir im wesentlichen, dass er seine Selbstdrehzigaretten in der Tasche herstellen konnte. Immerhin auch eine Leistung; ich konnte das nicht. Interessant immerhin, wer im Buch nicht namentlich erwähnt wird – Rolf-Ulrich Kaiser beispielsweise, obwohl der immerhin die ersten vier Tangerine-Dream-Alben auf seinem Label veröffentlichte.
Dabei hätte Froese ja durchaus einiges zu berichten. Seine Erfahrungen mit der amerikanischen Filmmusikproduktion sind schon interessant (und desillusionierend). Die Vorkommnisse vor einem geplanten Konzert in Marseille lassen einen wirklich nach Luft schnappen (nein, ich verrate es hier nicht). Der Abschnitt über die deutsche Community in Florida, die von der Band Countryrock und Tanzmusik aus dem Kohlenpott erwartete, könnte wirklich witzig sein, wenn sich Froese nicht so endlos verquatschen würde. Am schrecklichsten wird es immer dann, wenn er sich an Dialogen versucht. Die sind so umständlich und so hölzern, dass man geradezu den Wurm darin ticken hört.
Edgar Froese war eine knorrige Eiche, trutzig in die feindliche Landschaft gestellt und vom Sturmgebraus zerzaust. Angenagt immer wieder von dahergelaufenen Würmern, die nichts anderes zu tun hatten als ihm das Leben schwer zu machen, umringt von Figuren, die irgendwo auf dem Weg zum Primaten hängengeblieben waren, so stand er da, er konnte nicht anders. Des Lebens Unbill lastete zentnerschwer auf seinen Schultern, der Mann stand mit Jean Cocteau auf und ging mit Schopenhauer schlafen. Seite für Seite spürt man sein Kopfschütteln über die Banalitäten, die ihm das Leben tagein, tagaus zumutete. (Dass Froese über Kants kategorischen Imperativ promoviert habe, ist ein Wikipedia-Märchen.)
Nur im letzten Viertel des Buches, da passiert ein spürbarer Sprung. Da spricht plötzlich ein persönlicher Froese. Da berichtet er plötzlich von seiner familiären Situation, vom Tod seiner Frau, von seiner neuen Liebe, vom Zoff mit seinem Sohn. Da reflektiert er plötzlich über Musik und Gesellschaft. Und dazu hat er wirklich etwas zu sagen. Wäre das gesamte Buch auf diesem Level, man könnte sich nicht beklagen. Literarische Meisterleistungen erwartet man ja eh nicht.
Force Majeure ist erschienen in Froeses / Tangerine Dreams eigener Vertriebsfirma Eastgate Music & Arts und kann auch nur dort bezogen werden. Obwohl das Buch nur Text und eine Fotostrecke ohne Großfotos enthält, hat man sich dafür entschieden, das 420 Seiten starke Buch im unhandlichen Coffeetable-Format zu veröffentlichen. Einen ersichtlichen Grund dafür gibt es nicht — die Kosten mögen eine Rolle gespielt haben. Auch einen professionellen Buchgestalter wollte man sich anscheinend sparen, und so verschwindet jetzt der jeweils innere Rand des zweispaltig layouteten Textes annähernd in der Bindung, wenn man die Seiten nicht ständig flachgedrückt hält. Die Fotostrecke ist auf besserem Papier gedruckt, leider aber – in meinem Exemplar jedenfalls – schief ins Buch eingebunden und schlägt Wellen.
Tangerine Dream — Force Majeure
Die Autobiografie, geschrieben und zusammengestellt von Edgar Froese,
Add-ons von Bianca Froese-Acquaye
Eastgate Music & Arts
ISBN 978-3-00-056524-3
Berlin 2017