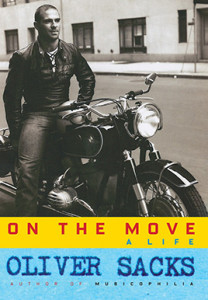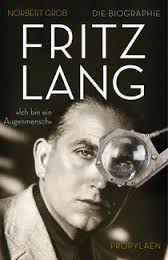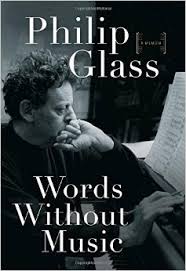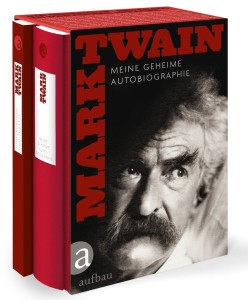Wenn dieser Mann nur nicht ein so verteufelt guter Musiker wäre. Dann könnte man den Inhalt dieses Werkes problemlos in die inzwischen einfalls- und konzeptlos dahintreibende TV-Soap „Nashville“ einfügen. So scheinbar unrealistisch ist das alles. Die zweite Hälfte des Buches ist über weite Strecken blanker Kitsch. Dummerweise nur entspricht vieles von dem, was Fogerty schreibt, den Tatsachen, und da für mich sein musikalisches Werk ziemlich idealtypisch alles repräsentiert, was für mich klassische amerikanische Rockmusik ausmacht, ist mir das Buch nicht egal.
John Fogertys Autobiografie, diese Woche auf Rang 15 der New-York-Times-Nonfiction-Bestsellerliste zu finden, ist eine Achterbahnfahrt. Lassen wir mal außen vor, ob er sie selbst geschrieben hat (ein Ghostwriter ist nicht genannt). Manchmal möchte man das Buch einfach nur zuklappen. Aber ähnlich, wie man bei „Nashville“ dann doch nicht abschaltet, so liest man auch hier weiter.
John Fogerty ist mehr als einmal übel mitgespielt worden. Diese Geschichten sollen hier nicht wiedergegeben werden, es würde zu lange dauern. Nur so viel: Die Band, die mal CCR werden sollte, ließ sich 1967 auf einen Plattenvertrag ein, den kein auch nur halbwegs vernünftiges Management abgeschlossen und den jeder halbwegs vernünftige Richter für nichtig erklärt hätte — wegen objektiver Unerfüllbarkeit. Es gab aber kein vernünftiges Management, es gab keinen vernünftigen Anwalt, Fogerty zog es vor, die Dinge selbst zu regeln, und deswegen hat Fantasy-Boss Saul Zaentz Fogerty in filmreifer Blutsauger-Manier jahrzehntelang systematisch vor sich her treiben können, bis die Geschichte schließlich ins Absurde kippte.
Dies alles wird in dem Buch in wahrhaft epischer Breite geschildert. Dazu gibt es einige eher belanglose Kindheits- und Jugendepisoden sowie einige Andeutungen über die Ehe der Eltern. Wirklich in die Tiefe geht Fogerty dabei aber nie, auch über seine Ehe mit Martha erfahren wir im Prinzip nur, dass es sie gab und dass sie irgendwann geschieden wurde. Das eigentlich Auffällige dabei ist auf der einen Seite John Fogertys bisweilen breitärschige Selbstgefälligkeit, und auf der anderen Seite seine offenkundige Unfähigkeit, sich auch nur für eine einzige Minute in die Position anderer hineinzuversetzen. Anregungen anderer kommen bei ihm nur an, wenn sie seiner Ansicht entsprechen. CCR entspricht zu keinem Zeitpunkt Johns Vorstellung von einer verschworenen Gemeinschaft, aber er erkennt nicht, dass er mit seinem eigenen Verhalten dazu beiträgt. Er erkennt in der entnervten Flucht seines Bruders Tom aus der Band nicht das Alarmsignal, das es ist. Toms folgende Soloalben erklärt er pauschal für schlecht, obwohl er wahrlich Musiker genug ist, um es besser zu wissen (immerhin sind sogar Musiker wie Jerry Garcia oder Merl Saunders daran beteiligt, die sich bestimmt nicht mit jedem abgeben). Seine verbliebenen CCR-Mitstreiter Stu Cook und Doug Clifford, die angesichts seiner ständigen Besserwisserei irgendwann rebellisch werden, hält Fogerty für intrigante Volltrottel, denen er überhaupt erstmal beibringen musste, wie man mit Messer und Gabel isst. Nein, die beiden waren keine Virtuosen und sind auch sonst keine Unschuldsengel, und als sie ihr gruppeninternes Stimmrecht für jeweils 30.000 Dollar an Saul Zaentz verkaufen, trifft ihn das tief — verständlicherweise. Dennoch: Unter normalen Umständen hätten sich diese Konflikte lösen lassen — doch nicht mit John Fogerty. Der überlässt sich lieber seiner zunehmenden Verbitterung und dem Alkohol. Jahrelang spielt seine eigenen Songs nicht mehr, bis ihn dankenswerterweise Bob Dylan auf offener Bühne quasi dazu zwingt („Wenn du es nicht tust, werden später alle glauben, ‚Proud Mary‘ sei von Tina Turner gewesen“).
Und dazu der immer noch ungelöste Konflikt mit Saul Zaentz und Fantasy Records. Am Ende jagt Zaentz Fogerty in den wohl absurdesten Prozess der Popgeschichte, den Fogerty zum Glück gewinnt. Aber woher das alles kommt: Bei Fogerty kommt es nicht an. Was immer seine Mitmenschen auch tun: Wenn es nicht das ist, was er für richtig hält, dann ist sein Urteil gnadenlos, ob es sein Bruder Tom ist, ob es CCR-Bassist Stu Cook ist (auf den er sich besonders eingeschossen zu haben scheint), ob es der Musikjournalist Ralph J. Gleason ist, ob es wer auch immer ist. Er verehrt alte Blues-Heroen, sein Urteil über andere Bands aus der San-Francisco-Szene ist dagegen oft übermäßig hart. Jefferson Airplane und Grateful Dead wirft er vor, sie könnten auf der Bühne nur endloses Genudel, aber keine Songs hervorbringen. Im Fall der Airplanes ist das schlicht falsch, im Fall der Dead scheint er das Konzept der Band nicht verstanden zu haben.
Bis dann endlich Julie die Szene betritt — eine annähernd 20 Jahre jüngere Zufallsbekanntschaft, die Johns große Liebe wird. Aber selbst diese Beziehung gefährdet Fogerty mit Alkohol und erratischem Verhalten. Erst, nachdem Julie das Management ihres Mannes übernimmt und ihr gesamtes Handeln darauf ausrichtet, ihm den Rücken fürs Komponieren und Musizieren freizuhalten, wird eine bis jetzt anscheinend glückliche Ehe daraus. Julie betritt das Buch in Kapitel 15 und schreibt ab dort eigene Textabschnitte, die sie in der 12 CDs umfassenden Hörbuchversion auch selber spricht.
Der Rest des Buches ist dann eitel Sonnenschein.
Fogerty ist, wen wundert’s, kein großer Autor. Aber darauf kommt es bei einem Buch wie diesem nicht an. Wer den Menschen John Fogerty und seine Sicht der Dinge näher kennenlernen möchte, wird aus diesem Buch eine Menge über ihn erfahren — das meiste allerdings zwischen den Zeilen. Die Geschichte der großen Hits, seine musikalischen Vorbilder, seine Liebe zur Countrymusik, seine etwas seltsamen Ansichten zum Thema Politik und Waffenbesitz (er trat mehrfach für die Demokraten auf, scheint aber dennoch zu glauben, dass die US-Regierung nur deshalb im Zaum gehalten werden kann, weil sie weiß, dass das Volk bewaffnet ist — die NRA wird jubeln), das alles ist da und wird durchaus unterhaltsam und gut lesbar geschildert. Die in amerikanischen Star-Biografien sonst unvermeidlichen ellenlangen Krankheitsgeschichten fehlen hier glücklicherweise.
Wer sich allerdings für eine objektivere Darstellung der diversen Sachverhalte um CCR und Fantasy Records interessiert, der scheint mir mit Hank Bordowitz‘ Buch „Bad Moon Rising — The Unauthorized History of Creedence Clearwater Revival“ von 1998 immer noch besser bedient zu sein.
Wenn dieser Mann nur nicht ein so verteufelt guter Musiker wäre.
John Fogerty:
Fortunate Son — My Life, My Music
Little, Brown & Co. 2015
ISBN 978-0316244572