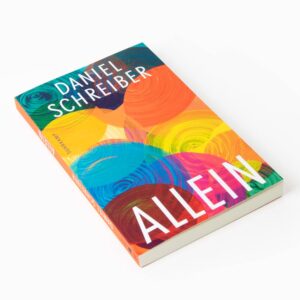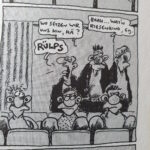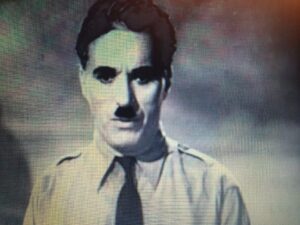Zu Daniel Schreiber, „Allein“, Verlag Hanser Berlin, 160 Seiten
„Und wir vergessen“, notiert Daniel Schreiber, „vergessen, auch wenn wir es nicht wollen, wer wir einmal waren. Wir brauchen Menschen, die uns genau davor bewahren.“ (17) Ich blieb an diesem Satz hängen und dachte lange darüber nach, verdichtet er doch Haltung und Überzeugung des Buches. Stimmt die LeserInnen darauf ein, in welcher Weise der Autor sich uns zur Verfügung stellen, seine Erfahrungen als Messinstrument einsetzen wird, zur Analyse gesellschaftlicher Umstände, er verfolgt dabei ein ähnliches Anliegen wie einst Joan Didion. Dieses Buch kann ein so persönliches sein, weil es vor Verallgemeinerungen der verwässernden Sorte und jeglicher Wohlfühl-Rhetorik zurückschreckt, auch bei allen inneren Betrachtungen erstaunlich diskret bleibt. Uns nur mit Fragen behelligt, die den Autor selbst umtreiben. Und das doch kein pessimistisches ist, obwohl es uns auch einlädt, den eigenen „grausamen Optimismus“ (29, Lauren Berlant) aufzuspüren.
Eine ganz eigene Gefühlsmischung begleitete mich bei der Lektüre des Buches, im wesentlichen ein Mischung aus Dankbarkeit und Trauer, ich fand es tröstlich, verschiedene Spielarten von Unbehagen in so klare Worte gefasst zu lesen. Um dann schmerzhaft festzustellen, dass damit allein ja noch nicht viel anzufangen ist: Das erspart Daniel Schreiber uns LeserInnen nicht, wenn wir bereit sind, den Blick auf die Krisen unserer Zeit zu richten, zum Beispiel auf die „neoliberale Umverteilungsmaschine, die für viele der sozialen, ökonomischen und ökologischen Notlagen, verantwortlich war“ (132/133), dass „jene gefürchteten Kippmechanismen eingesetzt hatten, die dazu führen würden, dass die Erderwärmung mit ihren Extremwetterlagen (…) nicht mehr aufzuhalten war.“ (133). Der Blick darauf sollte uns bewusst machen, dass wir hinsichtlich dieses Planeten als Lebensgrundlage alle zusammen gehören, nicht ausweichen können. In politische Verhältnisse, in einen sozialgeschichtlichen und philosophischen Zusammenhang eingebunden sind, egal wie klug und differenziert wir uns dazu äußern.
Wichtigster Auslöser für Daniel Schreibers Betrachtungen in „Allein“ war offenbar die Corona-Pandemie: In der Isolation realisierte der Autor, dass seine Erzählungen und Fantasien über sich und sein Leben als „gutes“ nicht länger Bestand haben, er zitiert dazu das Konzept des „uneindeutigen Verlusts“ (79) der Psychologin Pauline Boss, ein Konzept, das Schreiber in der zweiten Hälfte des Buches immer wieder zur Veranschaulichung einsetzt, um der überzuckerten Beschwörung von Kontrolle und Selbstwirksamkeit in allen Belangen entgegen zu treten. Leben ist Vergänglichkeit und Ausgeliefertsein, an Umstände, die wir womöglich nicht beeinflussen können – als Gegenentwurf schildert Schreiber ganz zum Schluss des Buches die Pracht des Gartens von Derek Jarman, einem schwulen Maler und Filmemacher, einer kargen Landschaft und der eigenen Krankheit abgerungen.
Schonungslos könnte man zu Daniel Schreibers Buch sagen, aber vor allem ist es voller Mitgefühl, das – wie der Autor überzeugend argumentiert – bei der eigenen Person beginnt: Er traut uns LeserInnen selbst große Empathie zu, wendet sich an den Teil unserer seelischen und körperlichen Ausstattung, der uns alle verbindet: Sollten wir nicht mehr darauf schauen, anstatt auf die Unterschiede? Sind diese nicht viel unbedeutender angesichts der drängenden Aufgaben unserer Zeit? – So macht uns der Autor Toleranz vor und fordert sie nicht nur. Er zeigt aber auch, welche Spuren an Körper und Seele Stigmatisierung und Marginalisierung hinterlassen und wie ideologisch das Gerede vom „guten Leben“ tatsächlich ist: „Bezeichnenderweise schlägt keiner der wiederkehrenden Propheten des sozialen Niedergangs vor, den Kampf gegen Einsamkeit mit dem Kampf gegen Rassismus, Misogynie, Antisemitismus, Homo-, Trans- und Islamophobie zu beginnen, gegen die gesellschaftliche Stigmatisierung von Menschen, die in Armut leben, gegen all die strukturellen Phänomene der Ausgrenzung (…) Die Antwort (…) liegt fast immer in der Beschwörung der Magie der Kernfamilie.“ (62)
Im Prinzip führt uns das Buch ein umfassendes und vielstimmiges Miteinander vor: Schreiber lässt eine Vielzahl von GesellschaftswissenschaftlerInnen und EssayistInnen zu Wort kommen – die Literatur-Liste im Anhang ist lang und vor allem im amerikanischen Sprachraum verwurzelt. Daniel Schreiber macht seine Gedanken als Ergebnisse von zum Teil jahre- und jahrzehntelangen Gesprächen und Lektüren sichtbar und legt somit auch nahe, dass sich die existentiellsten Erfahrungen der Unverbundenheit wohl außersprachlich abspielen und auch in diese erste Zeit des Menschen zurückführen (so muss es nicht verwundern, dass während der Pandemie bei so vielen Menschen solcherart schwer zu ertragende Grunderfahrungen aufgebrochen sind).
Wir brauchen einander, auf die vielfältigste Weise, und sollten das nicht vergessen, ruft Daniel Schreiber uns zu: Die von vielen heißersehnte und -beschworene Unabhängigkeit ist in Wirklichkeit an Privilegien geknüpft, der Herkunft, der Hautfarbe, der Veranlagungen – Und wie erstrebenswert ist es denn wirklich, fragt der Autor, immerzu tun und lassen zu können, was man möchte? Um welchen Preis? In unser aller Köpfen steckt die Erzählung, dass zum gelingenden Leben eine Liebesbeziehung gehört, und es lauert die Scham – sollte man keine haben – mit einem Makel behaftet zu sein, zuallererst in uns selbst. Aber wie kann man als Alleinlebender lebendig bleiben, der „Trockenheit des Herzens“ (96, Roland Barthes) entgehen?
Daniel Schreiber behandelt seine LeserInnen wie gute FreundInnen, er bietet seine Gedanken und Erfahrungen als Projektionsfläche an, als zählte allein, jeden Tag eine gute Tat zu vollbringen. Ein Apfelbäumchen zu pflanzen zum Beispiel, denn der Autor ist offenbar ein großartiger Gärtner.