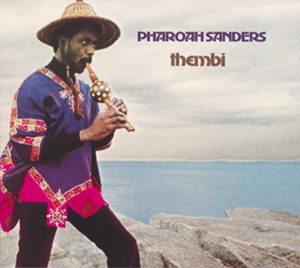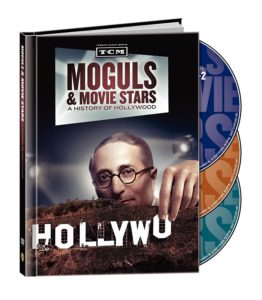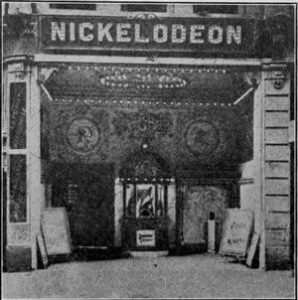„Immer wenn ich Bäume im Wind rauschen höre“ – so schreibt die Psychoanalytikerin Annegret Mahler-Bungers – „und es sonst ganz still und der Himmel bleiern ist, dann entsteht die Blow up-Stimmung, in der man eine Unruhe, eine unheimliche Bewegung in den Dingen spürt und an ihrer vertrauten Wahrnehmung zu zweifeln beginnt.“
Niemand hat es besser als Antonioni geschafft, im Wind rauschende Bäume so merkwürdig lebendig und eigenbewegt wirken zu lassen, dass einem gruselig wird und Unheilverkündendes schwant, eine seltsam belebte Natur, die etwas Geheimnisvolles in sich birgt. Zumindest so etwa erging es der Generation, die noch BLOW UP gesehen hat, einen der meistinterpretierten Filme überhaupt, bei dem man sich nie einigen konnte wovon er überhaupt handelt.
Findige Analytiker glaubten zu wissen, es handle sich bei der Begegnung des Photographen Thomas mit einem Pärchen im Park um das halluzinatorische Erleben der Urszene (also des Geschlechtsverkehrs der Eltern) und den danach erfolgenden Vatermord aus Eifersucht, wie jedes Phantasma sich bei genauerem Besehen in Nichts auflösend und damit die Situation des eigenen Gewordenseins in einem Verdrängungsprozess negierend. War was? Nö! Durchaus spannend zu lesen, wenn einen dergleichen interessiert.
Filme haben mehr Aufgaben als nur zu unterhalten, als blosses Entertainment funktioniert Blow up nicht; dieser Film wirft das Grosshirn an. Und er ist auch mehr als nur das Einfangen des Swinging Londons der Sechziger, wie von vielen Kritikern beschrieben. Hier swingt nichts, schon zu Anfang nicht. Der Fotograf Thomas, ein wenig sympathischer, seinerseits „aufgeblasener“ Typ, kommt aus einem Obdachlosenasyl, verschmutzt und zerzaust wie ein verirrtes Kind, und trifft auf eine sinnentleert wirkende Umwelt: Ein Trupp geschminkter Schausteller stürmt über die Strasse, ein paar Nonnen kreuzen den Weg, eine Palastwache bewacht ein verfallenes Haus, in dem es nichts zu bewachen gibt.
Es ist auch nicht nur ein Film über Bilder und ihre Wahrnehmung, über Realitäten und Imaginationen und ihre Relativität. Für mich war es immer eine Geschichte über Leben und Tod, Belebtes und Unbelebtes, wie öfter bei Antonioni (Die rote Wüste), der gern diese Gegensätze gegeneinanderstellt.
Zunächst ist es ist aber auch eine Geschichte über die hypomanische Jagd eines Hungrigen, der getrieben versucht, das Leben durch das ständig bereite Objektiv seiner Kamera – wie ein ständig aufgerissener Mund – einzufangen, und dem alles in Nichts zerrinnt, was er einzufangen versucht.
Das Lebendigste in diesem Film sind die Bäume im Park, ständig rauschend und unheimlich in ihrem Eigenleben, als würden sie zu Thomas sprechen und ihn warnen wollen. Doch das erlebte Drama löst sich wiederum in Nichts auf: Die Leiche im Park verschwindet, die Frau, die ihm die Filme abluchsen will, verschwindet am nächsten Morgen. War was? Nö!
Eine überhitzt und sexualisiert anmutende Fotosession, in der sich Fotograf und Model in einen gemeinsamen voyeuristisch-exhibitionistischen Rausch hineinsteigern, bricht Thomas plötzlich ab anstatt sie zu dem insgeheim erwarteten Ende zu führen.
Ein Besuch zweier junger Mädchen in seinem Atelier endet in einer kindlichen Rangelei, bis Thomas die Szenerie abrupt verlässt, wie er es immer tut, in Begleitung seiner Kamera, die mit ihm verwachsen scheint, sich mit Bildern füllen möchte als Teil seines Selbst. Das ist ein Handlungsstrang. Thomas sucht Leben und trifft auf Abgestorbenes – seine wie Schaufensterpuppen herumstehenden Models nerven ihn („Habt ihr vergessen, was Lächeln ist?“). Er befiehlt den Mädchen die Augen zu schliessen und sich nicht vom Fleck zu rühren, und verlässt das Atelier – ein Akt megalomaner Abwehr, als wäre er es, der Menschen zur Erstarrung bringen und wieder lebendig zaubern kann. In seinem phallischen Narzissmus wirkt er zunehmend kindlich. In einem Antiquitätenladen , umgeben von erstarrten toten Marmorbüsten erwirbt er einen Propeller – ein Objekt, das etwas in Bewegung versetzen kann wenn, ja, wenn es mit einem Motor verbunden ist, der ihm Leben verleiht.
So bleibt es bei einer ästhetischen Form; auch diese wird ihn bald nicht mehr interessieren. In einem Konzert der Yardbirds: die Zuhörer sitzen erstarrt und mit unbewegten Gesichtern auf ihren Plätzen, für Popkonzerte eher ungewöhnlich, ein einziges Pärchen tanzt, als hätte es Strippen an den Gelenken. Der Gitarrist zertrümmert seine Gitarre und wirft sie in das Publikum, das sich mit der gleichen Gier auf die Bruchstücke stürzt, mit der Thomas lebendigen Objekten hinterherjagt. Er erbeutet ein Stück und wirft es wieder weg, wie er alles schnell wieder loslässt bzw fallenlässt, ein gnadenloses Prinzip – ein „Auch-das-ist-nicht-das-Richtige“ scheint sein Leben zu beherrschen und zugleich zu entleeren. War was? Nö! Er scheint sich mit nichts verbinden zu können, nichts ist es wert, es zu Ende zu bringen.
Ein Freund, Maler, spricht mit ihm über seine Bilder – während des Malens begeife er nicht, was sie bedeuteten; erst später entdecke er ein Detail und „alles fügt sich zusammen“ zu einem sinnhaften Ganzen.
Erst am Schluss wendet sich das Blatt – Thomas geht wieder in den Park, die Bäume rauschen ihre geheimnisvollen Botschaften, er trifft auf eine bizarre Szenerie: eine Gruppe geschminkter junger Leute imitiert auf einem umzäunten Tennisplatz ein Tennisturnier, die Aufschläge des Balls sind zu hören, obwohl kein Ball existiert. Der Ball scheint über den Zaun geschlagen worden zu sein, mimisch und gestisch machen die Leute Thomas klar, dass er ihn zurückwerfen soll. Langsam malt sich Verstehen in seinem Gesicht, ein halbes Lächeln, etwas Resignation, Traurigkeit, Nachdenken – und ohne Kamera, die er sonst zwischen sich und die Welt schiebt, macht zum erstenmal einen schutzlosen Eindruck – ein ikonischer Moment der Filmgeschichte, mit vielen Deutungen bekränzt.
Ein pantomimisches Ballspiel erfordert genaue Beobachtung des anderen, seine Bewegungen müssen gelesen werden und der Flug des Balles erahnt, damit man in der Bewegung glaubhaft reagieren kann. Thomas pflegt zu regieren, nicht zu reagieren, hier tut er es zum erstenmal und wirft den Ball zurück, erkennt das Bedürfnis des anderen. Er hat zum erstenmal etwas gegeben und vielleicht gelernt, in einer gemeinsamen Phantasie mit anderen verbunden zu sein.
Man entdeckt ein Detail und alles fügt sich zusammen zu einem sinnhaften Ganzen – wie sein Freund bemerkte. Das Zauberwort das die Welt zum Singen bringt. Danach verschwindet Thomas, der Zuschauer bleibt zurück mit dem Bild einer leeren Wiese, der Regisseur dekonstruiert seine Figur.
Thomas macht nun mit dem Zuschauer das, was er am besten kann: Unmotiviert verschwinden. Es bleibt aber die Reminiszenz an die letzte Szene, er hat eine lebendige Spur hinterlassen.
War was?
Ja, vielleicht doch!