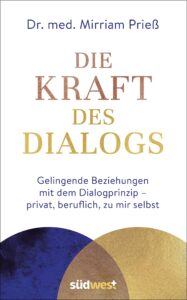Archives: August 2023
2023 21 Aug.
Heidschnuckenweg 6. Etappe: Soltau – Wietzendorf. Sonntagsspaziergang.
Alex | Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | Tags: per pedes | Comments off
Nach der 30 Km-Mammutetappe vom Vortag haben wir heute zivilisierte 18 Km auf dem Programm. Das Kerngebiet der Heide liegt hinter uns, ein Großteil der Strecke verläuft durch Mischwald, zum Teil an oder auf meist kaum befahrenen Straßen.
In Soltau flanieren wir durch die Fußgängerzone, die wir am Sonntagmorgen nahezu für uns alleine haben. Bis auf zwei Wandergenossinnen, die hier den zweiten Teil ihrer Heidedurchquerung beginnen. Eine Tafel an einer Hauswand (Foto) weist darauf hin, dass es in der Geschichte eine nicht vor Gewalt zurückschreckende Rivalität mit den Pfeffersäcken in Lüneburg gab. Der Weg aus dem Ort heraus führt uns durch die „Vorstadtromantik der Eigenheimsiedlungen“ (Wegbeschreibung).
Wir unterqueren mehrmals die Bahnlinie Berlin-Bremen, die auch als Amerikalinie bekannt wurde, weil sie im 19. Jahrhundert von vielen Auswanderern aus den östlichen Gebieten genommen wurde, um dann von den Nordseehäfen per Schiff den Sprung über den großen Teich zu wagen. Außerdem treffen wir mal wieder auf die A7, die wir dieses Mal überqueren. Der Verkehr nach Hamburg ist deutlich dichter als der Verkehr in die Gegenrichtung.
Ansonsten ist dieser Wandertag eher beschaulich und für die geplagten Füße entspannend. Hinter der Autobahn kommen wir zu einer idyllischen Badestelle an der Kleinen Aue, die eifrig genutzt wird. Wir treffen auf viele Jogger, einige Radfahrer, aber überhaupt keine Mountainbiker, die woanders häufig am Sonntag die Wälder unsicher machen. Ein junges Paar mit Hund hat um diese Jahreszeit sicherheitshalber immer einen Korb für Pilze dabei, sie haben ein paar Hexenröhrlinge gefunden. Etwas später sehen wir am Wegrand mehrere Prachtexemplare von Schopf-Tintlingen (Foto), eine ebenfalls essbare Pilzart, die mir auf den ersten Blick eher suspekt vorkommt.
Es geht nun an einer in hohem Tempo befahrenen Landstraße entlang, neben uns Artilleriefeuerstellungen (Foto), die Erinnerungen an meine unfreiwillige Bundeswehrzeit vor 40 Jahren wachruft. Heute herrscht hier allerdings Ruhe. Was auf diesem Weg irritiert, ist die mäandernde Wegführung. Es ist grundsätzlich so, dass unser Weg so gut wie immer länger im Vergleich zum Radweg bzw. der Straße ist. Die Differenzen sind bei kleineren Strecken manchmal knapp 50%, also z.B. 3,5 km statt 2,4 km. Häufig führt unser Weg dann wie heute idyllisch durch den Wald, das ist aber nicht immer so.
Kurz vor Wietzendorf sehen wir wie das Mähen der Wiesen abläuft. Im ersten Schritt wird die Wiese von der vom Traktor gezogenen Mähmaschine gemäht und anschließend zusammengekehrt, so dass am Ende lange Straßen von Grasschnitt auf der Wiese liegen. Nun kommt eine ebenfalls von einem Traktor gezogene Maschine zum Einsatz, die zum einen das Gras zu den bekannten zylindrischen Grasballen komprimiert, mit einem Strick befestigt und den Ballen sodann über ein rotierendes rundes Gestänge in Plastikfolie einpackt. Im Ergebnis gibt das die Plastikballen, in denen das feuchte Gras gären kann und im Winter als Futter (Silage) insbes. für die Rinder verwendet werden kann. Der Geruch dieser vergärenden Ballen ist etwas süßlich und erinnert mich an Dunhill-Tabak. Man riecht ihn viel auf allen Wegen, die durch landwirtschaftlich genutzte Wiesenflächen gehen. Ich liebe ihn.
In Wietzendorf überqueren wir die Wietze (Foto von Badestelle) und kehren im Eiscafé ein und trinken einen köstlichen Eiskaffee. Hier gibt es einen alten Glockenturm aus Holz (Foto) neben der Kirche sowie die Imkerstatue (Foto). Der Imker hat eine Pfeife im Mund, mit dem Rauch beruhigt er die Bienen.
2023 20 Aug.
The Male Gaze – Frauen im Zerrspiegel
Ursula Mayr | Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | 11 Comments
Lars von Trier beschäftigt sich gern mit Frauen und ihrem Innenleben, beobachtet Frauen, dreht über Frauen, bildhaft und szenengewaltig. Aber er berichtet nur scheinbar über Frauen, in Wirklichkeit berichtet er über Männer und ihre Art, die Frauen zu sehen, zu fürchten und zu dämonisieren, vor allem das Letztere.
The Male Gaze, eine bekannte Sichtweise, aber diesmal nicht in Form einer voyeuristischen Ausbeutung, Idealisierung und Objektualisierung der Frau und ihrer Reize im Film und das Bedienen von Männeraugen durch Schönheit, sondern die Verzerrung der archetypischen Frauen-Imagines durch den geängstigten Mann. Da kennt er sich verdammt gut aus. Wobei er sich durchaus selbst auch in diese Gruppe subsumiert, das spürt man und das macht den an sich relativ dysphorischen Kerl doch um einiges sympathischer. Zumindest kann er mehr als antisemitisch oder sonstwie dumm daherschwatzen. Insbesondere seine späteren Filme (ich beziehe mich hier insbesondere auf Antichrist, Melancholia und Nymphomania, aber auch Dogville und Breaking the Waves fliessen mit ein), letztere arbeiten ebenfalls mit archetypisch-mythischen Bildern der verschlingenden, kastrierenden, kindermordenden Frau und ihrer durch nichts endgültig zu befriedigenden Lust, die auch mal über Leichen geht, wenn nicht gleich über einen ganzen Friedhof. Die phrygische Göttin Kybele verlangte die Kastration von ihrer männlichen Fanbase.
Justine in Melancholia, die sich masochistisch mit einem auf die Erde zurasenden Planeten zu paaren bereit ist und bei der Hochzeitsfeier im Brautkleid einen anderen Mann benutzt, um ihrer Depression zu entkommen, ist so eine Gestalt. Antares, der Planet, ist inzwischen auf der Zielgeraden – der Zuschauer erfährt einen Impact als Justine mithilfe ihrer Drahtschlinge nachmisst, dass das Dingens schon sehr viel näher gekommen ist – hier eine gelungene Ikonographie. Das fährt einem in die Knochen. Antares ist ein Antagonist zu Ares, dem männlichen Kriegsgott, somit könnte man ihn durchaus als weibliches Gegenprinzip verstehen, aber ein Stück überwältigende Weiblichkeit, die sich ebenso zerstörerisch verhält wie der Kriegsgott und damit den Frauengestalten LvTs durchaus das Wasser reichen kann – in diesem Fall eher das Feuer.
„SIE“ – die namenlose Frau in Antichrist – lässt ihr Kind fahrlässig zu Tode kommen, um bei ihrem Orgasmus nicht gestört zu werden, verstümmelt ihm vorher die Füsse; laut Freud auch ein Kastrationssymbol, verfällt dann dem Wahnsinn und zerquetscht ihrem Mann die Hoden, der vorher vergeblich versuchte sie mit den Mitteln von Logik und Wissenschaft – er ist Psychologe – zu heilen; fast tötet sie ihn.
Der zweite Impact ist die Schlusseinstellung: „ER“, auch namenlos und damit entindividualisiert und somit als der „Mann als solcher“ gezeichnet, taumelt schwerverletzt durch den Wald, ihm – und damit dem Zuschauer – kommt eine schwallartig zunehmende Horde gesichtsloser Frauen entgegen – überflutend und beängstigend, ausgestossen aus dem Schoss der grossen Mutter Erde, einer Büchse der Pandora, sich unendlich schnell vermehrend und damit erinnernd an Homo Faber, den die Fruchtbarkeit des Urwaldes anekelte, die ständige Feuchtigkeit, Gärung und Vermehrung – „wo man hinspuckt keimt es!“ Die beängstigende Gebärpotenz der Frau. Damit entlässt uns der Regisseur wieder in unsere eigene Psychose, manchen Mann in die Frauenangst und den Frauenhass, manche Frau in die Betroffenheit darüber, wieviel Angst sie auszulösen imstande ist und wie das in ihre Beziehungen hineinwirkt. Und wieviel sie selber überhaupt dafür kann.
Wie Frauen wirklich sind, erfährt man bei LvT nicht und er ist klug genug das einzugestehen, wenn man ihn danach fragt.
In Nymphomania wird das Thema der unersättlichen Frau bis zum Überdruss des Zuschauers ausgereizt – die Frau als schwarzes Loch, das keinen Boden und keine Begrenzung mehr finden kann. In Dogville – ein Machwerk aus dem Rape-and-Revenge-Genre – ereilt Grace ihre verdiente Kollektivschuld, Strafe gleich im Vorfeld; sie wird als Sklavin gehalten, bis sie ihre Ketten sprengt und tabula rasa macht und in Manderlay dann nochmal einen Zahn zulegt. Die eher auf eine Theaterbühne passende Kulisse hebt den Film auf eine Ebene des Artifiziellen und Überindividuellen, erneut eher eine Parabel als ein Narrativ.
Die Frauen bleiben rätselhaft und ihre Sexualität hart an Abgründen manövrierend oder in diese hineinstürzend.
Schon Freud musste passen, wenn es um die Frage ging, was das Weib eigentlich wirklich will. Auf die naheliegende Idee, einfach mal seine Frau oder Tochter zu fragen, kam er nicht. Dabei sah man bei Anna sehr gut was sie NICHT wollte, nämlich noch einen Übervater an ihrer Seite, mit dem sie dann auch noch das Bett teilen und sechs Kinder grossziehen müsste. Das Besetztsein durch ihre Eltern und ihre Unterwerfungstendenz war bei ihr gravierend genug, die Herzensthrone waren gewissermassen schon besetzt; eine gesunde erwachsene Abgrenzung und Lösung ist in ihren Briefen nirgends zu spüren. So liebte sie nur Personen, die auch ihr Vater lieben konnte – Frauen.
Das hätte dem Alten zu denken geben können. Oder lieber eben doch nicht, man muss ja nun nicht alles wissen, was schmerzlich am eigenen Narzissmus kratzt. Da stochert man lieber weiter in Frauenseelen …
Somit ist jeder Film von LvT ein raffiniertes Vexierspiel mit doppelter Brechung und multiplen Verzerrungen von einem Betrachter der Betrachtenden der Betrachteten. Aber auch die Gutartigkeit und das Opferwerden der Frauen finden ihren Platz in manchen Filmen wie Breaking the Waves oder Dancer in the dark – hier sind wiederum die Männer toxisch und ihre Lynchjustiz sehr nahe. Man bleibt sich nichts schuldig, letztlich. Die Frauen verschwinden hinter ihren Bildern wie Nachbar Gott in dem bekannten Gedicht von Rilke, das von schmerzlicher Getrenntheit handelt, der letztlich nicht ganz zu eliminierenden Getrenntheit zwischen den Geschlechtern. Zu viele Bilder, als dass man sich noch sehen könnte.
2023 20 Aug.
Das dialogische Prinzip
Jochen Siemer | Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | Tags: Mirriam Prieß | 1 Comment
Vor Jahren, als ich mich nach der brutal guten Fernsehserie Sons of Anarchy fragte, warum wohl trotz des für Heinz und Heide Jedermann nicht gerade alltäglichen Ambientes im kalifornischen Rocker- und Drogenbandenmilieu alles so gefühlsecht rüberkam, recherchierte ich über den Macher und Regisseur Karl Sutter. Der war von dem Theater-Pionier Sanford („Sandy“) Meisner stark beeinflusst, der die Schauspieler einst dazu angeleitet hatte, unmittelbar und natürlich auf das Gegenüber zu reagieren und alles Gekünstelte in der Darstellung zu vermeiden. Diese Direktheit zeigte sich eben auch in einer Serie wie Sons of Anarchy, in der nicht nur die Charaktere ein tiefes, beim Betrachter Empathie erzeugendes Profil zeigten („more real than life“), sondern auch die Dialoge nah waren wie ein Boxkampf im Ring. Als mir später dann ein Video der Ärztin, Therapeutin und Buchautorin Mirriam Priess empfohlen wurde, dämmerte es bald: connective link muss das Stichwort „Dialog“ gewesen sein. Wie sehr doch Algorithmen mittlerweile unser Leben lenken! Nachdem ich nun ein Buch von ihr gelesen hatte, reflektierte ich ein wenig über das „dialogische Prinzip“, das sich ja nicht nur im alltäglichen Miteinander zeigt, sondern auch in inneren Dialogen. Humorvoll könnte man dann Szenen herausarbeiten, in denen beispielsweise ein internalisiertes und rigides Über-Ich die Restbestände kindlicher Unbescholtenheit regelrecht „fertig macht“. Eine persönlich beeindruckende Erfahrung in den Achzigern war ein Workshop des vom brasilianischen Theater-Theoretiker Augusto Boal konzipierten Theater der Unterdrückten. Man konnte eine vertraute Alltagsszene spielen, in dem dann Muster gegenwärtig wurden: eine Putzfrau etwa oder ein Handwerker bei der Arbeit. Dann tritt der cholerische Chef hinzu und fordert, man müsse aber schneller sein. Man achte auf die Körperhaltung! Heute hätte unsereins ja ein beherztes „Fuck you!“ parat, doch damals waren viele von uns Kinder einer Schwarzen Pädagogik. Wer mit sich selbst hingegen in den Dialog tritt, wie es die Therapeutin Mirriam Priess proklamiert, der wird vielleicht zunächst die Erfahrung tiefer Langeweile machen, in der erst einmal gar nichts passiert, bevor dann wesensgemässe innere Anmutungen frei werden. Auch hier geht’s zu wie beim Intervall-Fasten: ohne Abstandnahme bliebe der ganze Müll liegen.
2023 19 Aug.
Heidschnuckenweg
Alex | Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | Tags: per pedes | 10 Comments
File under shameless self-promotion: Für diejenigen, die noch Interesse an der Wanderung auf dem Heidschnuckenweg haben, hier geht es weiter. Ich wollte dieses Blog nicht mit Content vollballern, der nicht so richtig in das Konzept hier passt und zudem keine Resonanz gehabt hat.
2023 16 Aug.
Auf einer finnischen Sommerbühne
Olaf Westfeld | Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | 4 Comments
Ich hatte zwar überlegt, über mein Erlebnis auf einer finnischen Sommerbühne zu berichten, allerdings war der Plan meiner Trägheit zum Opfer gefallen, bis ich Lajlas feinen Text über die musikverrückten Finnen und ihre Festivals gelesen habe. Da ziehe ich doch gerne nach: Im Juli hatte ich zum zweiten Mal die Gelegenheit, dass Odysseus Festival auf der Insel Lonna in der Bucht vor Helsinki an zwei von drei Tagen zu besuchen.
Lonna ist klein – ich vermute, man würde keine 10 Minuten brauchen, sie zu umrunden. Darauf befinden sich mehrere Gebäude, in denen ein Café, ein Restaurant, natürlich ein Saunabereich und eben eine Art Veranstaltungszentrum untergebracht sind. Zwei rote Backsteingebäude (mit jeweils einer Bühne) stehen parallel zueinander, zwischen Ihnen waren eine Bühne und ein Barbereich aufgebaut. Auf dieser Bühne ist es sicher nicht ganz leicht zu spielen, die Musiker sind dem kühlen Ostseewind ungeschützt ausgesetzt. Für die Zuschauer ist es magisch, einen freien Blick auf das Wasser zu haben. Es kommt dann auch zu skurrilen Situationen: So war das Ronald Langestraat Trio (Barroom Jazz from Outer Space) irritiert, als plötzlich und unvermittelt der Großteil des Publikums die Mobiltelefone zückte, um einen Dreimaster zu fotografieren, der gerade hinter ihnen segelte. Es gab noch eine ganz kleine Spielstätte, auf der ich eine Formation namens „Phardah“hörte, die Musik von Pharoah Sanders sehr beseelt und virtuos interpretierten.
In den Seitengebäuden herrschte eine intime Atmosphäre. Am Samstag sah ich zunächst Teppo Mäkynen (einen meiner Lieblingsmusiker) und Petter Eldh als „Eldhrok“ gut gelaunt Jazz, Hip-Hop und elektronische Musik verschmelzen, am Ende des Abends verzauberten Jeremiah Chiu und Marta Sofia Honer mit einem analogen Synthesizer, einer Geige und Feldaufnahmen ihr Publikum. Am Sonntag spielte Petter Eldh in einem der Seitengebäuden als „Post Koma“ noch ein Solokonzert, dass ich deutlich besser fand als electronic pioneer Carl Stone, doch nicht ganz so gut wie die zähflüssigen und überwältigenden Klangtexturen von Fennesz.
Auf der großen Bühne haben mich drei Konzerte begeistert: am Samstag Abend brannte die Marthe Lea Band – Entschuldigung – ein Feuerwerk aus Free Jazz und Nordischer Folklore ab. Sehr hohes Energielevel, unglaubliches Konzert. Deren Schallplatten waren hinterher leider ausverkauft, ich muss mir irgendwie eine aus Norwegen bestellen oder von F. mitbringen lassen. Am Sonntag war das Valteri Laurell Nonett der perfekte Start in meinem Tag. Die Musiker erzählten sich gegenseitig Geschichten, hielten Dialoge, spielten sich die Bälle zu. Rebirth Of The Cool. Es war eine Freude, genauso wie der Gig von Linda Fredriksson, die mit einem Program aus ihrem ja auch hier geschätztem Album Juniper das Festival beenden durfte.
2023 16 Aug.
Die zweite Etappe: die Maschine übernimmt
Alex | Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | Tags: per pedes | Comments off
Morgens gleich zwei Schocks. Die Klamotten sind nicht richtig getrocknet und heute Morgen ist Regen angesagt. Kein Spaß morgens in feuchte Socken zu steigen, aber was will man machen und außerdem schneller als auf dem warmen Körper trocknen die Sachen nirgends. Das heiße Teewasser tröpfelt langsam aus dem Automaten, Geduld ist angesagt. Es sind gefühlt Horden von Wanderern im Hotel und wir sind so ziemlich die letzten, die frühstücken und sich auf den Weg machen, als draußen schon fast die ersten Tropfen fallen. In Buchholz-Zentrum wird uns in einer Drogerie eröffnet, dass Bandagen schon seit längerem nicht lieferbar seien. Es trifft sich gut, dass das rechte Knie eigentlich nicht mehr schmerzt. Den Regen nutzen wir für eine Capuccinopause, drei rüstige Rentner, die im selben Hotel übernachtet hatten, tun selbiges. Wir treffen sie heute immer wieder, sie laufen etwa in unserem Tempo, man hört sie von weitem, da sie permanent reden, zwei Schwaben aus Göppingen (Märklin und Handball) bei Stuttgart und ein Bremer. Sie bleiben oft stehen und machen viele Pausen, sie machen es richtig, wollen heute bis Wesel (ca. 28 km), da sie vorher keine Unterkunft gekriegt haben.
Hinter Buchholz kommen wir in einen Mischwald und nähern uns der Höllenschlucht, einem periglazialen Trockental. Am Wegesrand wieder viele Pilze. Léo Gantelet, der einen sehr empfehlenswerten Verbindungsweg zwischen der Via Gebennensis (Genf – Le Puy) und der Via Tolosana (auch voie d’Arles) initiiert hat, schrieb mal davon, dass nach vielen Kilometern Wanderns irgendwann der Weg anfängt, unter den Füßen hinwegzugleiten. Das ist sozusagen das Satori des Wanderers. In diesem lichten Mischwald auf weichem Boden komme ich diesem Zustand schon recht nah. Ich würde es allerdings anders formulieren. Meine Beine gehen von alleine, die Wandermaschine übernimmt, ich werde gewandert. Kurz nach dieser umstürzenden Erkenntnis bin ich natürlich mal wieder umgeknickt, hingeflogen und weich gefallen.
Von der Höllenschlucht geht es hinauf zum Brunsberg, dem Dach der heutigen Etappe mit 129 m. Wanderwege aus allen Richtungen laufen auf diese mitten in der Heide stehende Erhebung zu, es ist hier ein reges Treiben. Wir machen eine kurze Trinkpause, lauschen dem Wind, der durch die vereinzelt herumstehenden Birken weht. Wenn man genau hinhört, kann man ein ganz leises Summen vernehmen. Die kleinen Heidebienen schwirren von Erikablüte zu Erikablüte. Man sieht viele durch im Kreis aneinander befestigte Holzlatten geschützte Wacholdersträuche, die angepflanzt wurden und so nicht von den Schafen gefressen werden können. A propos, der Boden ist überdeckt mit den rundlichen, dunkelbraunen Hinterlassenschaften der Heidschnucken, sie können nicht so weit sein, wir sind ihnen dicht auf der Spur.
Unsere Mittagspause machen wir auf dem Pferdekopf (78 m), wo die rüstige Rentnertruppe kurz nach uns eintrifft. Eine Wolke über uns verliert einige Tropfen, ansonsten bleibt es für den Rest des Tages trocken. Hier sind wir wieder mitten in der violett blühenden Heide. Wir kommen an zwei Weihern vorbei, wo blaue Libellen unterwegs sind. Nun geht es auf einem breiten Sandweg durch das Büsenbachtal zum Schafstall, einem beliebten Café mit kleinem Laden, wo wir ein kleines Kopfkissen mit Kräutern und Duftpflanzen für ein Geschenk erwerben. Der weitere Weg ist wenig ersprießlich. Wir gehen neben Straßen auf hartem Untergrund zum Supermarkt in Handeloh und dann noch nach Höckel, unserer Airbnb-Unterkunft. Dort treffen wir unsere Gastgeberin, die gerade die Pferdekoppel „entäppelt“, damit der Boden nicht zuviel Stickstoff bekommt und die Pferde genug zu grasen haben. Wir lassen den Abend draußen auf der Terrasse vor unserer Einliegerwohnung bei Pizza und Bier ausklingen.
2023 15 Aug.
Navigieren durch den inneren Raum. Ein Beitrag zur Jürgen Ploog-Rezeption
Martina Weber | Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | Tags: Jürgen Ploog | 8 Comments
Diese Aufmerksamkeit hätte Jürgen Ploog gern noch erlebt: ein Foto von sich, wie er im Jahr 1974 als Enddreißiger lässig in Jeansjacke, mit vor der Brust verschränkten Armen und mit halb geschlossenen Augen gegen die Motorhaube eines Autos lehnt, hat es auf das Cover eines Essaybandes über die Beat- und Undergroundliteratur geschafft, und das Buch wurde am 17. Juni 2023 sogar in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung besprochen. Doch in dem Buch „Gegen die Fußgängermentalität“ von Simon Sahner beschränkt sich die deutsche Beat- und Undergroundliteratur mit den Protagonisten Carl Weissner, Jörg Fauser und Jürgen Ploog auf die Zeit der sechziger und siebziger Jahre – wieder einmal, denn es war geradezu ein Trauma von Jürgen Ploog, dass seine Bücher immer wieder in dieser zeitlich begrenzten Schublade landeten und dass seine Arbeit seit 1980 oder 1990 kaum mehr in größeren Kreisen rezipiert wurde. Dabei war Jürgen Ploog mit seinen Publikationen seit 1980 in eine neue Schaffensphase eingetreten und hatte seine Arbeitsmethode auch seither immer wieder verfeinert. „Nächte in Amnesien“, 1980 erschienen, erlebte im Jahr 2014 sogar eine Neuauflage bei MOLOKO PRINT mit einigen neuen Kapiteln. Im Nachwort zu dieser Neuauflage schreibt Jürgen Ploog ein paar Sätze, die sich wunderbar zu einer einführenden Charakterisierung seiner Arbeit eignen: „Wenn der Leser sich fragt, in welches chronotopische Umfeld ihn diese fragmentarischen Episoden entführen (an welche Orte & in welchen erzählerischen Zeitverlauf also), ist er auf dem richtigen Weg. Er hat es mit einem System von Schnittpunkten zu tun, das nur mit einer Umorientierung der Vorstellung zu erfassen ist.“ Was ist mit dieser Umorientierung der Vorstellung gemeint? Es ist das Zentrum von Jürgen Ploogs literarischem Universum. Hier scheiden sich die Lesenden, die Literatur als Konsumgut betrachten, indem sie eine lineare Handlung nachvollziehen, von denen, die dazu bereit sind, die gängigen westlichen Wahrnehmungsmuster rationaler Logik zu verlassen, den Begriff der Realität in Frage zu stellen, und der unberechenbaren Kraft des Zufalls einen wesentlichen Stellenwert einzuräumen. „Europäer wissen nicht, dass sie sich in einem Labyrinth bewegen, dass sie Gefangene eines vorgegebenen Musters sind“, schreibt Jürgen Ploog in „Der Raumagent“. Mit seiner Art, die Welt, das Leben und vor allem sich selbst zu betrachten, ist Jürgen Ploog auch nach seinem Tod am 19. Mai 2020 ein hochinteressanter Autor. Für mich zählt er zu meinen wichtigsten literarischen Einflüssen.
Es begann – mit einem Zufall. Ich fuhr mit dem Fahrrad auf der Bockenheimer Landstraße Richtung Alte Oper und entdeckte ein Plakat mit einem Portraitfoto von Jürgen Ploog, der Ankündigung einer Lesung für den 25. Juni 1998: „Schreiben ist eine grundsätzliche Demonstration. Katastrophenberichte eines semantischen Raumfahrers“. Jürgen Ploog stellte die zweite Auflage seines Buches über Burroughs vor („Strassen des Zufalls“). Ich hatte damals noch nichts von Burroughs gelesen, war mit der Lesung überfordert, Neonsplitter, ein viel zu großer Saal und im Publikum fast ausschließlich Männer mit einer Ausstrahlung von Underground, viel älter als ich, und sie wirkten wie Insider bedeutsamer Botschaften, die ich noch nicht begriffen hatte. Ich bestellte „Der Raumagent“ in der Deutschen Nationalbibliothek, ein Titel, der mir gefiel. Ich schlug das Buch im Lesesaal auf, las eine halbe Seite, schlug das Buch wieder zu und gab es zurück. Ich mochte die Stimmung nicht, die Begegnung, die Art, wie sich ein Mann gewaltsam Zutritt zur Wohnung einer Frau verschaffte, die Machtausübung, die aufgesetzte Coolness, der kurze Dialog. Jürgen Ploog war für mich erstmal abgehakt.
Fünfzehn Jahre später erschien mein erster Gedichtband. Im Feedback wurden immer wieder die Schnittstellen zwischen den Sätzen hervorgehoben. Ich beschloss, dem „Raumagenten“ eine zweite Chance zu geben. Diesmal sprang der Funke über und ich las mich in den folgenden Jahren durch das Ploog‘sche Universum. In „Facts of Fiction“, einer Zusammenstellung von Essays zu Literatur aus den Randzonen, formuliert Jürgen Ploog „die einzige & wichtigste Frage in der Auseinandersetzung mit jedem Schriftsteller (…): Wie sieht sein Universum aus, was geschieht, wenn man es betritt & wohin führt es mich?“ Im Fall von Jürgen Ploog ist es zunächst leichter zu sagen, was dieses Universum nicht ist: Die als „Stories“ („Nächte in Amnesien“) oder „Erzählungen“ („Raumagent“) betitelten Texte sind keine herkömmlich erzählten Geschichten. Andere Bücher wie „Pacific Boulevard“ oder „Ferne Routen“ sind schon nicht mehr mit literarischen Gattungsbezeichnungen versehen. Was üblicherweise in Kurzgeschichten oder Romanen im Vordergrund steht – das Erzählen einer Geschichte, eine genau austarierte Spannungskurve, faszinierende Charaktere, ein zentraler Konflikt –, das alles spielt in Jürgen Ploogs Prosa überhaupt keine Rolle. Die Storys brechen mit allen Regeln. Es gibt zwar meistens einen Icherzähler, die Erzählperspektive ist jedoch uneinheitlich und kann sich innerhalb eines Textes ändern. Personen werden eingeführt, die im weiteren Verlauf nicht mehr vorkommen. Bestimmte Namen tauchen seit Jahrzehnten in Jürgen Ploogs Büchern auf: Grips, Max, Kiki, Lorita, Maier, Johnnie, Luzi, aber ich wäre nicht in der Lage, besonders viel über sie zu sagen. Wurde Luzi nicht mit einem langen Schal gesehen? Die Figuren scheinen keine Geschichte zu haben, keine Persönlichkeit. Oder haben sie ihre Vergangenheit vergessen? Nur fragmentarische Erinnerungen, eine Begegnung von früher vielleicht. Ein Beziehungsding. Geschäfte. Oder beides zugleich. Jürgen Ploog über Grips, den Piloten: „Etwas hatte seine Erinnerung ausgelöscht, seitdem suchte er sie, er hastete von Ort zu Ort, dorthin, wo Orte miteinander verschmolzen.“ („Ferne Routen“). Das Unterwegssein ist eine Konstante. Verabredungen mit Personen, die einander nicht kennen. Reisen in einen imaginären Raum. Erinnerungen blitzen plötzlich auf. „Wenn ich vom Reisen spreche, dann meine ich eine meditative Übung.“ („Der Raumagent“).
Zentral in den Texten von Jürgen Ploog ist ein innerer Zustand, das Bewusstsein, ein Unterwegssein im Bewusstsein, besser noch: an den Rändern des Bewusstseins, an den Rändern dessen, was mit Worten ausgedrückt werden kann. Eine seltsame Art von Trance. Da sind sie wieder, die halb geschlossenen Augen. Drogen sind auch mit im Spiel. Ploogs Texte gehen über die Sprache hinaus, vor allem gehen sie über das westliche Denken hinaus, und sie beziehen das Schweigen mit ein. Bei all den manchmal etwas nervigen Piloten, Agentinnen, Replikantinnen, schrägen Typen und krummen Deals, überraschenden Wiederbegegnungen und unerwünschten Abenteuern ist es auch dies, was mich an Ploogs Prosa fasziniert: Man spürt, man erfährt, dass hier jemand schreibt, der sich schon in den sechziger Jahren an Orten aufgehalten hat, die gewöhnliche Bewohnerinnen und Bewohner Europas nicht erlebt haben: Indien, Nepal, Thailand, Malaysia, Marokko, Mexiko und Venezuela.
Reisen nicht nur durch den Raum, sondern auch durch die Zeit. „Wenn Zeit reißt, dann sind es die entfernten Bilder, die schlagartig näher rücken.“ („Der Raumagent)
Kennzeichen von Jürgen Ploogs Texten: Unberechenbarkeit, Widersprüche, Traumlogik, Magie, Poesie, ungesehene Bilder, etwas Wildes, Weisheit, ein filmischer Blick, ständige Brüche, kosmische Energie, keine „Greifbarkeit“, Genreübergreifend (meist wird Essay und Prosa gemixt), Mysteriöses, Bedrohliches, Unheimliches, Archaisches, Existenzielles, Flüchtiges, ein Freiheitsgefühl, Verunsicherung, Nebensächlichkeiten. Insgesamt eine Zersetzung des sogenannten Realen. An die Stelle des Ursache-Wirkungs-Prinzips tritt Synchronizität.
Jürgen Ploog hat seine Schreibmethode in fast allen seinen Prosaarbeiten reflektiert. „Mein Ziel ist, jenseits von Sprache im schnellen Flacker der Bilder zu sehen. Dies ist im Film, die ist in der Schnitttechnik möglich.“ (Raumagent). Die Schnitttechnik oder Cut-up hat ihren Ursprung in einer zufälligen Entdeckung des Malers und Schriftstellers Brion Gysin in einem Pariser Hotel des Jahres 1959. Er hatte den Tisch, auf dem er malen wollte, mit Zeitungspapier bedeckt, zerschnitt die Zeitung, um den Tisch besser damit abdecken zu können, verschob also die Zeitungsspalten, und bemerkte das kreative Potential, das sich in den Schnittstellen verbarg. Es war dann zunächst W.S. Burroughs, der in seiner Literatur mit der Schnitttechnik arbeitete.
In seiner ersten Arbeitsphase hatte Jürgen Ploog Texte anderer auseinandergenommen und in harten Schnitten miteinander kombiniert. Im Lauf der Zeit hat er die Arbeit mit der Schnitttechnik stark verfeinert. Ein Beispiel dafür, wie aus einem längeren Text von Thomas Collmer ein typischer Ploog-Text entsteht, kann man in der #6 der Zeitschrift „Rollercoaster“ vom November 2009 bestaunen.
Das zentrale Anliegen von Jürgen Ploog besteht darin, mit Hilfe der Schnitttechnik Bilder, Gefühle und Zustände entstehen zu lassen, die bisher nicht artikuliert wurden, die vielleicht gar nicht artikulierbar sind.
„Sich niemals auf Sprache verlassen.“ (Unterwegssein ist alles).
Das ist der Durchbruch in den Grauen Raum. Das Reisen an imaginäre Orte. Es geht um die Fähigkeit, durch den inneren Raum zu navigieren und das Unmögliche zu denken. Dies ist auch von politischer Bedeutung.
Bereits im Jahr 1980 hat Jürgen Ploog seine Methode in dem Text „Showdown des Okzidents“ aus der von ihm herausgegebenen Anthologie „Amok Koma“ geschildert und seine Botschaft formuliert: „Max Lang, ein Pilot in meinen Texten, der selten Bodenberührung hat, kam mit der erstaunlichen Frage: Wohin führt Bewegung im Raum? Oft genug setze ich ihn an einen Ort mit unbekannten Koordinaten & verfolge dann so genau es geht, was passiert. Wenn es eine Botschaft seiner Erfahrung gibt, dann heisst sie wahrscheinlich: Schau dich genau um, wo du bist, sei dir klar, dass es keine Grenzen gibt, ausser dir … Raum ist keine Dimension, die ausserhalb existiert, Raum beginnt hier, um dich (…) Lass dich nicht festnageln, lass dir nicht vorschreiben, wohin die Strasse führt … (…)“
„Frage: Was ist das Ziel einer langen Reise?“
„Vergessen.“ (Ferne Routen)
Nur das Vergessen ermöglicht es, in den imaginären Raum vorzudringen.
Das ist der Grund, weshalb sich die Figuren im Ploog-Universum kaum an etwas erinnern.
Nächte in Amnesien.
Für die Lektüre von Jürgen Ploogs gilt das, was Burroughs über „Naked Lunch“ schrieb: Man kann sie an jeder Stelle aufschlagen und zu lesen beginnen.
2023 15 Aug.
Die erste Etappe ist die Schwerste
Alex | Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | Tags: per pedes | Comments off
Von Hamburg-Neugraben bis Buchholz-Steinbeck sind es nur rund 25 km auf dem Heidschnuckenweg, aber die hatten es gestern in sich. In der Fischbeker Heide schlängelt sich der Weg immer wieder von links nach rechts und zurück, das Höhenprofil ist leicht wellig. Nach dem Segelflugplatz wandern wir geradeaus auf der Grenze zwischen Hamburg und Niedersachsen, allerdings geht es nun in die Vertikale immer wieder recht steil rauf und runter, über Stock und Stein auf einem von Baumwurzeln übersäten Weg. Wir kommen ins Schwitzen. Ein etwa gleichaltes Paar kreuzt dauernd unseren Weg. Erst machen sie Rast auf einer Bank in Tempelberg, wir kommen vorüber und grüßen mit „Moin“, sie zurück, dann pausieren wir im Mischwald, sie gehen vorbei etc. Im Wald treffen wir auf drei Generationen einer ukrainischen Familie. Großvater und -mutter mit Tochter und Söhnchen. Die Großmutter hat einen Korb mit Pilzen. Reizker und Maronenpilze (mit Lamellen). Sie spricht gut deutsch, kennt die Pilznamen auf deutsch. Wir gucken beeindruckt in den Korb, was dem kleinen Jungen gar nicht gefällt, er fürchtet, dass wir die Pilze wegnehmen und insistiert, dass es ihre Pilze sind, er scheint verängstigt, guckt mich mit großen Kinderaugen an, ich muss daran denken, wo sein Vater wohl jetzt gerade ist. Später kommt aus einem anderen Waldstück ein mittelalter Mann, die Hände voller Pilze, mit einem selbstzufriedenen Lächeln auf den Lippen. C. fragt, ob es Steinpilze sind, er bejaht.
Mittagspause auf einer Bank mit Blick auf den Fernmeldeturm Langenrehm, der Wiesenweg zieht sich langsam links von uns den leichten Hang hinauf. Während unserer Rast kommen mehrere Wanderer vorbei. In Langenrehm ist Halbzeit, wir haben etwa 12,5 km hinter uns gebracht. Die zwei Liter Wasservorrat sind erschöpft. Unser Wasserverbrauch enorm, bei sommerlichen Temperaturen um die 25 Grad und viel Auf und Ab eigentlich nicht so erstaunlich. Mitten im Weiler der ausgedehnte Reiterhof der Familie Lücking, eine Art Abenteuerspielplatz für Kinder mit zwei echten Dampfloks, einem krokodilartigen Holzstamm etc. Wir treffen ein paar Kinder an, die uns in Richtung Reithalle weisen. Dort ist niemand während der Siestazeit. Wir sehen einen Gärtner, der uns den Weg zur Hauswand mit dem Wasserhahn unter dem metallenen Tornister weist. Dadrüber steht „Durstlöscher für Wanderer“.
Am Wegesrand treffen wir zweimal auf als Schutzhütten eingerichtete Bauwagen. Drinnen sieht es gemütlich aus, das Getränkeangebot ist vielfältig.
Am Wegesrand immer wieder Findlinge, meterhohe Steine vom Sand glattpoliert während des Schmelzens der Gletscher in der vorletzten Eiszeit. Das eindrucksvollste Exemplar der nach Karl dem Großen benannte Karlstein in den Schwarzen Bergen vor Rosengarten. Ein rund zwei Meter hoher und noch etwas breiterer Stein mit einigen Furchen, er erinnert etwas an ein Gehirn.
Im Wald kreuzt ein Prachtexemplar von Hirschkäfer unseren Weg. Während wir heute gut 10% der Länge des Heidschnuckenweges durchschreiten, schafft er es in Nullkommanichts den Weg einmal zu queren.
Vor Nenndorf ein infernalisches Tosen, vor uns die A261, unter der wir durchgehen. Danach sogar noch ein Stück, wo sie parallel zum Weg verläuft, kurz vor Dibbersen dann noch neben dem Autobahnzubringer – die Brombeeren am Rande mehr als reif – und dann über die A1, das war es dann heute erstmal mit dem Autobahnlärm. Wobei wir anschließend noch an einer Kiesgrube vorbeikommen, wo reger Lkw-Verkehr herrscht und die Landschaft völlig zerschnitten ist.
Im Wald vor Buchholz-Steinbeck, unserem Etappenziel, treffen wir auf einen Mann mit zwei Hunden, mit dem wir ins Gespräch kommen. Der eine Hund, der aussieht wie ein stämmiger Irischer Wolfshund stellt sich als altdeutscher Hütehund heraus, er braucht gerade eine Pause, legt sich hin, ein eher phlegmatischer Zeitgenosse, der uns an die Berner Sennenhündin erinnert, mit der wir regelmäßig Gassi gehen. Der zweite Hund ein aufgedrehter schwarzer Zwergpudel, der mich sofort adoptiert, sich hochstellt gegen mein Bein und Streicheleinheiten verlangt. Anschließend umtänzelt er den massigen Hütehund und schleckt sein Gesicht ab. Immer wieder schön zu sehen, Zärtlichkeit zwischen Tieren bzw. das, was wir dafür halten.
Gegen Ende werden die schweren Beine wieder etwas leichter, die zusammengeschrumpften Schritte wieder etwas länger, das vor uns liegende Ziel weckt noch einmal letzte schlummernde Kräfte. Insgesamt eine sehr abwechslungsreiche Etappe, ich ärgere mich etwas den Weg, was die vielen vertikalen Amplituden angeht, unterschätzt zu haben, die Wanderstöcke hätten uns gut unterstützen können. Beide Kniee schmerzen jetzt etwas, ich benötige auf jeden Fall noch eine zweite Bandage. Die beiden Stürze am ersten Tag wie meistens harmlos auf weichem Boden und perfekt wie ein Judoka abgefedert. ;-)