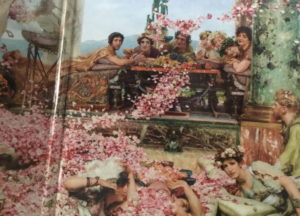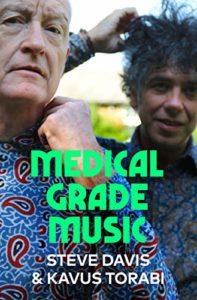Love Story (USA, 1970) Arthur Hiller, Roman von Erich Segal
Klar, der Film ist vorhersehbar und ein Tränenzieher, kein Nägelkauer. Die Kritiken lobten ihn überschwänglich als „Liebesfilm für die Ewigkeit„, „zeitloses Märchen„, und er spielte das 60-fache seines Budgets ein. Er wurde gepriesen als „aus der Zeit herausgelöste und an keinen gesellschaftlichen Kontekt gebundene romantische Liebesgeschichte„, die die Herzen der Menschen geöffnet habe. Und das mit dem gesellschaftlichen Kontext stimmt aber eben nun so gar nicht.
Die Liebesgeschichte ist nur scheinbar nach dem bekannten boy-meets-girl-Muster gestrickt, in Wirklichkeit ist es eine Love Story zwischen Vätern und ihren Kindern – ein gross angelegter Versöhnungsversuch in den Zeiten der unerwünschten Jugendrevolte.
Oliver, ein Jurastudent aus schwerreichem Hause, verliebt sich in das Aschenbrödel Jenny, Tochter armer italienischer Einwanderer. Er revoltiert gegen seinen Vater, einen schwerreichen Industriellen. Jenny steht in unbedingter Loyalität zu ihrem Vater, nach dem frühen Tod ihrer Mutter „war sie es, die für ihn sorgte!„. Zitat Vater! Eine rekrutierte Tochter, bereits als Kind dafür zuständig, den Emotionshaushalt der Erwachsenen zu regulieren, wie so viele Kinder, die dazu verdonnert sind und es erst im Erwachsenenalter bemerken, wenn überhaupt. Deutsches Nachkriegsphänomen unter anderem!

Natürlich ist sie als Schwiegertochter nicht erwünscht, eine Mesalliance. Natürlich bricht Oliver mit seinem Vater, lebt mit Jenny glücklich zusammen, inzwischen wurde geheiratet, ohne Anwesenheit von Olivers Eltern, und er verdient sein Geld als junger Anwalt. Jenny leidet unter dem Zerwürfnis zwischen Vater und Sohn, nimmt Oliver seine Härte übel – die Frau ist gemäss tradiertem Kontext für das Gefühlsleben zuständig, und ein Kind steht zu seinen Eltern, egal was sie damit anstellen – klar – sie ist Italienerin, viva la famiglia – und bleibt damit bei ihren Leisten. Und Musikerin. Ein Ingenieurstudium der weiblichen Hauptfigur war sogar damals noch degoutant. Und Oliver bleibt bockig.
Jenny stirbt an Leukämie, Oliver weint in den Armen seines Vaters, der doch noch ans Sterbebett eilt. Die Mutter Olivers tritt kaum auf, auch jetzt nicht. Die Funktion Jennys als Katalysator ist durch die Versöhnung erloschen, sie wird nicht mehr benötigt. In sich stimmig, dieser Tod.

Als Topos einer Spielwiese für Betuchtere fungiert hier der Central Park, in dem sich die Paare finden, übermütig herumtoben, Probleme knacken und sich schliesslich wieder verabschieden müssen – gleichsam eine Art Terrarium des akademischen Milieus von Manhattan für uns zum Hineingucken. Auf dem letzten Spaziergang des Paares sieht Jenny sichtlich stolz Oliver beim Eislaufen zu, übernimmt damit die Rolle des Vaters, der in einer Anfangssequenz Oliver beim Eishockey zusieht, mehr besorgt als stolz über seinen wilden Ableger. Sie schafft somit die Übergabe Olivers aus dem Bereich der Partnerliebe wieder zurück in den Raum der Vaterliebe, die Old Stonyface, wie Oliver den Vater nennt, so schwer ausdrücken kann.
Aber es geht noch weiter mit dem subliminalen Geniesel von reaktionären Botschaften auf des Unterbewusstsein einer widerspenstigen Jugend:
Teil 2 naht: Olivers Story, 1978, John Corty, Roman dito Erich Segal.
Der verlorene Sohn kehrt heim in das Haus des Vaters, die Betriebsübernahme winkt, das aber erst später. Zunächst lebt Oliver als trauernder Witwer und aufstrebender Junganwalt, engagiert sich für soziale Projekte. Die Partnerwahl, die er nun trifft ist jetzt eher comme il faut, man entwickelt sich. Marcie, die er beim Joggen kennenlernt – natürlich im Central Park – ist eine schwerreiche Erbin. Die Beziehung knirscht bald, da Oliver noch stark an Jenny gebunden ist, zudem wirft ihm Marcie vor, Jenny nur als „Eintrittskarte in die Unterschicht“ und als Kampfmittel gegen den Vater funktionalisiert zu haben. Ein durchaus kluger Gedanke, den man in diesem Film nicht erwartet hätte.
In der Zwischenzeit entwickelt sich ein Handlungsstrang, in dem Oliver seinen Vater näher kennenlernt. Dieser interessiert sich auch für alte Industriedenkmäler und -kulturgüter, und sei ein – laut Auskunft eines Angestellten – verständnisvoller Arbeitgeber gewesen, mit dem man immer über alles reden hätte können.
Vater und Sohn versöhnen sich, Oliver übernimmt den Betrieb, trennt sich aber von Marcie. Es endet mit dem Satz: Wenn Jenny noch leben würde, würde ich auch noch leben. Hier wird der bürgerlich-romantische Mythos der ewigen Treue beschworen, also keine Abgrenzung, kein Abschliessen, kein Neuaufbruch.
Somit transportiert der Film seine Botschaften:
Kapitalisten sind im Grunde nette Kerle, die sich um ihre Angestellten kümmern.
Es gibt eine grosse Liebe und die ist ewig.
Es muss in jedem Fall geheiratet werden, weil’s einfach romantischer ist.
Liebe und ehre Deine Eltern, egal wie sie sich aufführen.
Nimm den Platz ein, der vom Leben oder vom Papa für Dich vorgesehen ist.
Mit letzterem hat man unsere Kinder und Enkelkinder schon im „König der Löwen“ gepestet, bei der Forderung des Einfügens in den eternal circle für den jungen Simba, der mit seinen Freunden Timon und Pumbaa ein fröhliches Hakuna-Matata-Leben im Busch führt. Dann erschien aber Evas Fluch in Gestalt seiner Jugendfreundin Nala, die ihn an seine Pflichten als Thronfolger erinnerte und der grollende Geist des Vaters wurde aus den Wolken beschworen, bis der lustige Bursche die Bürde auf sich nahm. Als ob es keine anderen Löwenmännchen gegeben hätte, die vielleicht eher Lust darauf gehabt hätten. Tatsächlich tauchen im Film auch keine auf, das Rudel scheint nur aus Damen zu bestehen, die die Situation offenbar nicht bewältigen können bzw gar nicht erst auf diese Idee kommen. Ein zusätzlicher Druck für den jungen Alleinretter. Disney unter pädagogischem Gesichtspunkt betrachtet kann ganz schön übel sein, oder wie ich zu sagen pflege: Brutale Einnordungsmaschinerie.
Offenbar bekam die Company dann 1994 doch Druck, denn Simba bekam im Teil 2 eine Tochter, Chiara, als Quotenfrau, die die Thronfolge übernahm an der Seite eines jungen Löwenfreaks und Drop-outs, der dem Papa zuerst so gar nicht gefiel, sich aber später als wackerer Prinzgemahl entpuppte.
.

Das ganze ist jetzt nicht meine Privatparanoia, es ist bekannt, dass bei vielen Filmen – vor allem Militaria – das Pentagon als Produktionspartner mit im Spiel ist und Gelder zur Verfügung stellt, insbesondere im Vorfeld militärischer Aktionen – und natürlich entscheidet, welche messages transportiert werden sollen. Damit im Hinterkopf ist das Konsumieren von Machwerken wie „Top Gun“ ein sehr bittersüsses Vergnügen, da kann sich Tom Cruise noch so sehr anstrengen, gnadenlos gut auszusehen.
Oder „Der Gladiator“ von 2000, nach der Afghanistaninvasion und im Vorfeld des Irakkrieges, der ständig den Imperialismus feiert („Es gab einmal einen Traum von Rom!“). Mit einem guten Imperator vorndran ist der nämlich eine prima Sache. Insbesondere die Macher populärer Filme können auf kostenlose und kompetente Beratung der Militärbehörden hoffen, vorausgesetzt, der Film folgt propagandistisch den Linien der laufenden oder geplanten US-Militäroperationen. Oder lässt sich dementsprechend hinpfriemeln.
Wer bei Love Story mitgepfriemelt hat, wurde leider nicht publik, vielleicht gab’s damals ein entsprechendes Sitten- und Erziehungsdezernat zur Bekämpfung von Hippies.
Hierzu auch: Peter Bürger – Kino der Angst (2006).