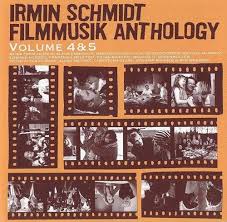Vor langer Zeit begegnete mir „Sans Soleil“, auf einer Videokassette im letzten Jahrhundert. Ein Film, der einen Abend bereicherte, neben guter Musik und patati patata. Die zwei Frauen auf dem Futon waren spezialisiert auf das amerikanische Undergroundkino, und lasen mir zwischendurch immer mal Zeilen aus einem rororo-Filmbuch vor. Die meisten Filme, um die es ging, habe ich vergessen – nicht aber einzelne Sätze und Blicke, die durch den Raum flogen, und es war wohl das letzte Mal, das ich in einem Raum voller Patchouli das feeling alter WG-late-night-Rituale erlebte, und ab einem gewissen Zeitpunkt hätte ich eine Runde guten Sex gerne gegen Schnitt-Gegenschnittdiskussionen eingetauscht. Aber die Ladies waren lediglich einander zugetan, und so versuchte ich mich ein wenig locker zu machen, und diesen bedroom-talk selbst wie einen Film zu erleben. Ich hatte dafür auch ein bestens passendes Buch dabei, und streute gelegentlich ein Kapitel von Richard Brautigans „Forellenfischen in Amerika“ ein. Und, holla, es gab eine selten erlebte Einstimmigkeit klanglicher Präferenzen: wo Neil Young und Steely Dan einen Raum teilten, ist sowieso alle Verbissenheit auf und davon. Und nicht ich war es, sondern Karin, die sagte, „Sans Soleil“ sei eine Tranceinduktion. Keine Frage, der Film hinterlässt so viele Lücken, Spalten, Kammern – dass er, mit seltsam flüchtigen Sätzen aus dem Off, geradezu nach Traumdeutung ruft, und einem Weiterwirken des Gesehenen. So sei hier erinnert an Martinas Text zu „Sans Soleil“. Und endlich ist dieses Stück Kinomagie auch allgemein zugänglich. (m.e.)
„Die Sache, die den meisten von uns fehlt, und vor allem auch den Cineasten, das ist die Z-e-i-t. Die Zeit zu arbeiten, und auch nicht zu arbeiten, die Zeit zu reden, zuzuhören und – vor allem – zu schweigen, die Zeit zu filmen und keine Filme zu machen, zu verstehen und nicht zu verstehen, erstaunt zu sein und zu warten auf das Staunen, die Zeit zu leben.“ Dies schrieb Chris Marker in einem Essay zu „Kashima Paradise“, einem Dokumentarfilm, der im Jahr 1974 in Paris lief.
Chris Marker hatte sich Zeit genommen, für ausgiebige Reisen, fürs Fotografieren, zum Schreiben. Er setzte verschiedene Mythen über seine Herkunft in die Welt, benutzte einen Künstlernamen und ließ sich nicht gern fotografieren. Anfang der 50er Jahre begann er, Filme zu drehen. „La Jetée“ (1962) ist ein Science-Fiction-Kurzfilm, eine Erzählung, die aus einer Aneinanderreihung von Schwarzweißfotos besteht. Es geht darum, Zugang zu einem zentralen Erinnerungsbild zu finden. Wir befinden uns in einem zerstörten Paris während oder nach dem dritten Weltkrieg. Eine Eschertreppe.
„Sans soleil“ oder auch „Sunless“ kam 1983 in die Kinos und wird unter der Rubrik „Essayfilm“ gehandelt, ein Meilenstein in der Filmgeschichte ist es allemal. Ich habe „Sans soleil“ erst vor etwa vier Jahren gesehen, da muss der Film im Fernsehen gelaufen sein, ich fand den Film konfus und anstrengend, aber auch anziehend, und ich spürte, dass der Film etwas hatte, mit dem ich mich genauer beschäftigen wollte, wenn die Zeit dafür passend war, weil ich den Zugang haben würde, zu dem Themenkomplex Reise, Erinnerung, Gedächtnis, Unterbewusstsein, Geschichte.
Normalerweise würde kaum jemand den Text zu einem Film recherchieren und lesen wollen. Bei „Sans soleil“ macht es Sinn, jedenfalls wenn man versuchen möchte, das Gespür für die Magie des Filmes zu verfeinern, das Wiederaufgreifen von Motiven, das Januarlicht auf den Treppen, die Zeremonien, Verführungsrituale, die Poesie und wie Hunde herumtollen am Meer.
Ich gehöre zu denen, die es lieben, sich zu verzetteln, cut-ups in Raum und Zeit, und ich saß mit einem kleinen Ordner an Filmbesprechungen zu „Sans Soleil“ und Essays aus Fachbüchern in einem Café-Antiquariat in Budapest, die Nachmittagssonne schien schräg auf die Bücherregale, ich hatte einen iced Matcha-Latte ausgewählt und es war wahrscheinlich der friedlichste Ort, den ich in dieser Stadt finden konnte.
Die Offenheit in der Struktur, das Gegeneinanderspiel von Bild, Ton und Text, das Gesagte und das Ungesagte, eine Liste von allem, was das Herz höher schlagen lässt. Bruchstücke eines Spiegels, das Eintauchen in einen kollektiven Traum. Eine Frau gibt wieder, was ihr ein Mann (der Kameramann) schrieb oder erzählte. Der Reichtum an Themen ist enorm, manches wird angerissen, angedeutet, an anderer Stelle wieder aufgenommen oder auch nicht. Der Text ist weitaus eigenwilliger als ein traditioneller Essay.
Der Film gibt vor allem Einblicke in die japanische Alltagskultur, kleine Alltagsrituale, das Stehenbleiben vor Ampeln, der 15. Januar als der Tag der zwanzigjährigen Frauen, die mit ihren Winterkimonos durch die Straßen spazieren. „Die Weide betrachtet umgekehrt / das Bild des Reihers“ (Basho). Wie funktioniert das Erinnern? Wie funktioniert das Vergessen? Es gibt das Denkmal eines treuen Hundes, der seinen Herrn jeden Tag am Bahnhof erwartete, auch als dieser gestorben war.
Kaum jemand im Westen weiß vom kollektiven Trauma in Okinawa gegen Ende des zweiten Weltkriegs. Chris Marker hat das Thema in seinem Film „Level five“ wieder aufgegriffen und dabei die Witwe des Programmierers eines Computerspiels in den Mittelpunkt gestellt, in ihrem Versuch, im Computerspiel den Verlauf der historischen Geschehnisse zu verändern.
„Sans soleil“ ist ein Palimpsest, eine Partitur, die Einblendungen diverser Dokumentarfilme anderer Filmemacher enthält. Bilder aus Afrika, aus Island, aus Guinea-Bissau. Auch mal: minutenlanges Schweigen. Das Herzzerreißende der Dinge. Flaschen, die aus dem Fenster geworfen wurden. Es gibt die „Zone“, ein Begriff, der allen vertraut ist, die Tarkowskijs „Stalker“ gesehen haben, und der hier, bei Chris Marker, für die eigene Erinnerung steht: bearbeitetes Material, speicherungsfähig. Das Digitale, seine Möglichkeiten, seine Zerstörungskraft.
„Sans soleil“, das ist, so heißt es im Text, eine Materialsammlung für einen Film, der nie gedreht werden soll. Und sind es nicht die Widersprüche in einem Kunstwerk, die wir suchen, die Leerstellen, die Risse, durch die wir die Kraft des Lichts umso intensiver fühlen, weil wir sie nur ahnen?
Es gibt eine längere Passage über den einzigen Film, der, so heißt es, das wahnsinnige Gedächtnis auszudrücken vermag, Hitchcocks „Vertigo“. Die Suche nach den Schauplätzen in San Francisco. Alles war da. Die Brücke, das Auge des Pferdes, die Bucht. Der Briefschreiber (Chris Marker oder der Kameramann) hat „Vertigo“ neunzehn Mal angeschaut. So weit würde ich nicht gehen. Ich könnte mir eher vorstellen, „Sans Soleil“ neunzehn Mal anzusehen.
Der Film ist in seiner Gesamtstruktur so wenig greifbar wie die Magie eines vielschichtigen Gedichtes, er entsteht in jedem Betrachter auf andere Art. „Sans soleil“, das ist auch der Versuch, sich an einen Moment des Glücks zu erinnern. Der Film beginnt mit einem schwarzen Startband, ein Moment des vollkommenen Glücks. Die Schnitttechnik zeigt erst am Ende, wie gefährdet dieses Glück bereits zu Beginn des Filmes war. „Sans soleil“ ist der Versuch, einen Trost zu schaffen, für etwas, wofür es keinen Trost geben kann.