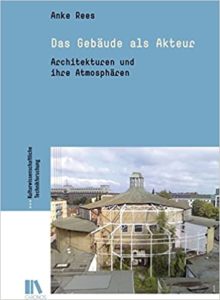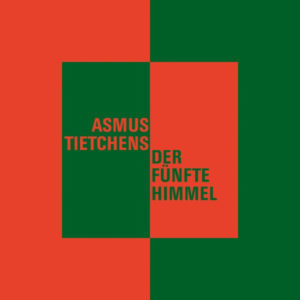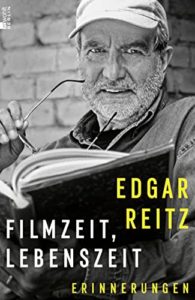Lilli:
Entsinnst du, wie der Elefant gestorben ist?
Max:
Das weiß ich noch, ja.
Da habe ich dagestanden, wie sie ihn auseinandergeschnitten haben,
damit sie ihn aus dem Hof rauskriegten.
Lilli Rober und ihr Bruder Max. Bis 1908 sind die beiden im Ensemble, sie als Tänzerin, er als Schauspieler und Wasserpantomime. Als die Stiefmutter Lilli wieder einmal mit dem Feuerhaken verprügelt, reißt Max nach Amerika aus.
Eine von vielen Geschichten um die Schilleroper in Hamburg.

1890. Das markante Rundgebäude wird als stationärer Zirkus mit 1000 Plätzen errichtet, mitten zwischen überbevölkerten Hinterhöfen, Passagen- und Terrassenwohnungen im cholerageplagten Altona, das damals noch zu Dänemark gehört. Eine Gegend, in der die Miete mit dem Revolver kassiert wird. Stahlgerüst, Wellblechwände, Pappdach, die Baukosten betragen 38.000 Mark. Betrieben vom Wanderzirkusunternehmer Paul Busch ist der Zirkus die Antwort Altonas auf die Konkurrenz, den einen knappen Kilometer Luftlinie entfernten Circus Renz in Hamburgs Rotlichtbezirk St. Pauli. Der Bau ist auch ein direkter Affront des Altonaer Magistrats gegen den übermächtigen Nachbarn Hamburg.
2016 habe ich das Gebäudeensemble zuletzt gesehen. Der Rundbau mit seinen teils ein-, teils zweistöckigen Nebengebäuden liegt im Schnittpunkt von St. Pauli, Karolinen- und Schanzenviertel, wenn auch von diesen abgetrennt durch zwei der dicksten Verkehrsadern Hamburgs. Für Stadtplaner gleichwohl eine Top-Lage, ein Filetstück mitten in einem hochverdichteten Wohngebiet, dessen Einwohnerschaft allerdings noch immer allergisch auf unerwünschte Eingriffe reagiert hat – die berühmt-berüchtigte „Rote Flora“ ist nur einen Katzensprung entfernt. Die Stahlkonstruktion der Rotunde gilt als Beispiel frühindustrieller Tragwerksarchitektur, deshalb ist das Gebäude geschützt. Der Gebäudekomplex darf nicht betreten werden, es besteht Einsturzgefahr, zudem kann man, wenn man nicht aufpasst, in ungesicherte alte Abflussrohre treten. Nachts spielen hier die Ratten Billard, die Nebengebäude, in denen sich zeitweilig einige Kleingewerbetreibende niedergelassen hatten, stehen jetzt leer und sind vernagelt. Niemand weiß, was mit der Schilleroper passieren soll. Im Prinzip scheinen die Besitzer darauf zu warten, dass das Stahlgerüst von selbst zusammenbricht. Ein Schelm, wer dahinter Absicht vermutet.

Um 1900 erhält der Circus Busch eine weltweit einmalige Sensation: eine Manege, die hydraulisch abgesenkt und geflutet werden kann. Man spielt eine Wasserpantomime namens „Sibirien“ und lässt zwölf Eisbären aus der Kuppel auf einer Rutsche ins Wasser platschen. Zwischen den Vorstellungen stehen die Eisbären auf einem Schrottplatz in der Nähe. Der Autoverwerter, dem der Platz gehört, existiert noch heute.
1905 schließt der Circus Busch seine Pforten und zieht nach St. Pauli in den Circus Renz. Der Architekt Ernst Michaelis übernimmt das verlassene Haus und baut es zu einem Theater mit 1400 Plätzen um. Zur Eröffnung spielt man Schillers „Was ihr wollt“. Die Bühnenarbeiter des Schiller-Theaters, wie das Haus seitdem heißt, kommen aus der Nachbarschaft – Werftarbeiter, für sie ein Nebenverdienst, den sie gut gebrauchen können. Lilli Rober tanzt mit dem später populären Stummfilmdarsteller Lupu Pick den Cakewalk, man spielt niederdeutsche Komödien, Sittenstücke und zu Lokalrevuen umgearbeitete Klassiker. Aus einer solchen Revue geht der Hit „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ hervor. Ein 21-jähriger Nachwuchsschauspieler, den man vom Hamburger Operettenhaus abgeworben hat, wird damit zum lokalen Star, ein gewisser Hans Albers:

Der Hamburger Dichter Robert Walter wird Dramaturg. Er nimmt heitere und ernste Stücke ins Programm, gern auch Patriotisches. Im Sommer, wenn die Hamburger Staatsoper Ferien hat, heuert er deren Musiker an und lässt Opern spielen, aber auch für artistische Shows und Ringkämpfe ist man sich nicht zu schade. Das Gebäude lässt das alles zu.
Dies alles vermischt sich mit dem Leben ringsum. Die Kulissenmalerwerkstatt ist die Straße, der nahegelegene Kohlenhändler kümmert sich um die Tiere, die auf der Bühne eingesetzt werden, die Komparserie stammt aus der unmittelbaren Nachbarschaft, ebenso wie die Kinder, die fürs Weihnachtsmärchen benötigt werden. Klempnermeister Willy Küker entzündet nicht nur allabendlich das Gaslicht im Haus, sondern betreibt auch die Theaterkneipe, in der seine Frau den Theaterleuten, Musikern, Artisten und Nachbarn Bier, Kartoffelsalat und Eintopf serviert. Die Klempnerei liegt um die Ecke, sie existiert noch.

Im Ersten Weltkrieg werden Benefiz-Veranstaltungen für gefallene Offiziere gespielt und treffen sich hier illegal die örtlichen Sozialdemokraten. 1917 übernimmt Hans Pichler das Haus, der Schwiegersohn des Schauspielhaus-Direktors. Von dort wird er auch unterstützt. Trotzdem geht Pichler 1921 pleite. Das Haus wird kurzfristig vom Altonaer Stadttheater mitbespielt. 1922 hat in der nahegelegenen Flora die Revue „Wie steht der Dollar?“ Premiere. Sie ist so erfolgreich, dass Flora-Direktor Max Ellen sie im leerstehenden Schiller-Theater weiterspielen lässt und die Leitung des Hauses übernimmt.
Bis zum Beginn der Nazi-Ära bietet das Schiller-Theater nun alles, was man als „die Zwanziger Jahre“ im Kopf hat. Freche Revuen mit Batterien dressierter Tänzerinnen gibt es ebenso wie Klabunds „Kreidekreis“, Marieluise Fleißers „Pioniere in Ingolstadt“ oder Brechts „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ – Stücke, die in direkter Konkurrenz zu Erich Ziegels Hamburger Kammerspielen mit ihrem Publikumsliebling Gustaf Gründgens stehen. Spuren davon finden sich später in den Büchern Klaus Manns – real („Der Wendepunkt“) und halbfiktiv („Mephisto“). Auch Laienspielgruppen der Arbeiterbewegung nutzen die Bühne. Gegen Ende der 20er Jahre kommt es in dem prinzipiell roten Viertel um das Theater herum zunehmend zu Zusammenstößen zwischen SA und Kommunisten, gelegentlich zu Schießereien. Einige Einschusslöcher sieht man noch.

1933 wird unter einem Vorwand der jüdische Direktor Max Ellen entlassen. Nach einem Umbau heißt das Gebäude nun „Oper im Schiller-Theater“ oder kurz: „Schilleroper“. Zur Eröffnung gibt man den „Freischütz“. Man versucht zu lavieren: Einerseits spielt man „Der Wanderer“, ein Stück von Joseph Goebbels, andererseits wird Musik von Ernst Krenek oder Paul Hindemith aufgeführt, Franz Lehár dirigiert selbst die Premiere seiner „Giuditta“.
1939, mit dem Stück „Sonnenstrahl im Hinterhof“, endet die Theatergeschichte der Schilleroper. Sie wird geschlossen, weil keine Luftschutzräume vorhanden sind. Im Gebäude werden Kriegsgefangene untergebracht, später dann ausgebombte Familien aus der Nachbarschaft. Bombentreffer tun ein Übriges.
Die Schilleroper wird nach Ende des Krieges nicht wieder als Theater in Betrieb genommen. Sie dient vorrangig als Lagerraum und Garage. 1951 richten Motorradartisten die Rotunde für eine Steilwandnummer her, danach passiert lange nichts mehr. In den 60er Jahren beherbergt die Schilleroper kurzfristig ein Hotel, später werden dort „Gastarbeiter“, wie man sie nennt, von der Werft Blohm & Voss untergebracht. In den 70er Jahren gibt es einige Brandstiftungen und kurzfristig zieht ein Kulturverein ein. Für die Spielzeit 1980/81 möchte das Deutsche Schauspielhaus die Schilleroper als Ausweichbühne nutzen. Statt dessen ziehen wiederum ausländische Arbeiter in die Nebengebäude ein, im ehemaligen Foyer eröffnet ein italienisches Restaurant. Das wird bald wieder geschlossen – wegen verbotenen Glücksspiels.

Immer wieder werden seither neue Nutzungspläne entworfen und wieder verworfen – weitere Zirkuspläne, ein Musikclub, ein Kino, ein Haus für Swing-Musikpartys. Nichts davon wird realisiert, es werden Asylbewerber einquartiert. 2008 zeigt Bernhard Paul vom Circus Roncalli Interesse, das Gebäude zu mieten. Man lässt ihn abblitzen. Die um die Rotunde herum liegenden Gebäude — frühere Künstlergarderoben, Büros etc. — werden zeitweilig von Kleingewerbetreibenden genutzt.

Es bildet sich eine Anwohnerinitiative, die das Gebäude auf sozialverträgliche Weise reaktivieren will. Der Stadtplaner Jo Claussen-Seggelke legt einen Plan vor, aber die Eigentümer wechseln wiederholt. Derzeit gehört das Gelände einer Objekt-GmbH, der Geschäftsführer ist ein Rechtsanwalt. Niemand weiß, wer tatsächlich hinter dieser Firma steht.
Und das Gebäudeensemble verfällt, weiter und weiter.

2021. Man weiß inzwischen, wer die Eigentümerin ist. Sie tritt selbst nie in Erscheinung, aber irgendwie gelingt es ihr immer wieder, die Vorgaben des Bezirksamtes nicht zu erfüllen — oder sie so zu erfüllen, dass der Verfall des Ensembles weitergeht. Die Gebäude sind schließlich nicht mehr zu retten. Die Eigentümerin lässt sie abreißen. Wie nicht anders zu erwarten, lässt sie auch das Hauptgebäude weiter verrotten, mit dem Argument, es stehe ja nur das Stahlgerüst unter Denkmalsschutz. Das Bezirksamt findet keinen Weg, dagegen vorzugehen. 2022 schließlich lässt die Besitzerin sämtliche Gebäudeteile abreißen; es steht wirklich nur noch das nackte Stahlgerüst.

Das ist der traurige Rest. Mit dem kann nun niemand mehr etwas anfangen, und man benötigt nicht viel Fantasie, um sich ausrechnen zu können, wie lange die Stahlkonstruktion dem Wetter noch ungeschützt standhalten kann. Das Bezirksamt sollte sich selbst anzeigen — wegen Dummheit im Dienst.
Was bleibt, sind Fotos und Erinnerungen, die Dissertation von Anke Rees
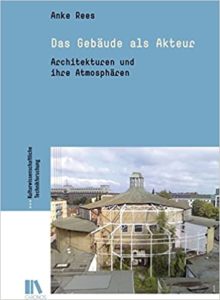
sowie ein schönes Buch und ein dazugehöriger Dokumentarfilm von Horst Königstein, gedreht 1980.

Den Film sollte der NDR einmal wieder aus dem Archiv holen. Das Buch findet man gelegentlich noch gebraucht.