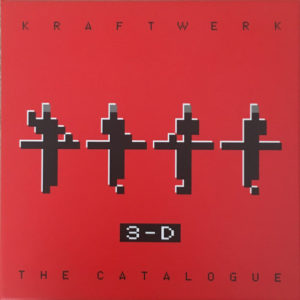Da bist du, allein, gestrandet. Das Raumschiff, auf dem du erwachst, kreist um einen unbekannten Planeten, die Elektronik ist abgeschaltet, weder weisst du, wer du bist, geschweige denn, wann. Dumm gelaufen. Ein Mix diverser Science-Fiction-Topoi. Und was passiert nun?
Der potentielle Horror der Situation wird erstmal gemildert durch den Bordcomputer, der dir „Wach auf, wach auf!“ zuruft, bevor er dich anweist, den Generatorknopf zu drücken, um den Strom anzuschalten. Das bringt deinen „Dinge-Macher“ ins Spiel, der dazu da ist, Dinge zu machen. Unglücklicherweise wurde die umfangreiche Bibliothek der machbaren Dinge erheblich beschädigt – anstatt nun also schlichweg alles mögliche erzeugen zu können, bleibt es einzig bei Kartoffeln – mit einem gewissen Potential.
Ein närrisches Spiel voller bizarrem Humor, doch trotz aller Skurrilität bleiben zum Ende hin sehr nah gehende Emotionen nicht aus. Wie gut, dass sich aus diesen Kartoffeln einiges herstellen lässt, das pure Verzweiflung unterläuft! Du und dein Computer lösen das Geheimnis des Planeten durch einen recht grotesken Einsatz der Kartoffeln. Nach einigen Stunden nimmt das Spiel eine Wendung, und grössere Themen geraten ins Blickfeld.
Du entwickelst einen Plan, die Erde zu retten, indem du rückwärts durch die Zeit reist, oder, eher vorwärts, bis sich die Zeit umkehrt, so dass du technisch rückwärts in der Zeit reist, bis du den Ursprung, den „Big Bang“ erreichst, und genau an diesem Knallpunkt beginnt die gute alte Tante Zeit vorwärts zu strömen. Natürlich verläuft das nicht plangemäss, es entwickelt sich eine quantensprunghafte Reise Richtung Heimat. Das alles bisher war nur der Prolog zum ganz grossen Abenteuer.
Wir spielen lang genug, bis das Spiel seinen Ton gefunden, seine Voraussetzungen geschaffen hat – ein Universum einer auf Kartoffeln basierenden Aeronautik und Astrophysik – und der grosse Showdown in Sicht kommt (stell dir „2001 – Odyssee im Weltraum“ vor, gefiltert durch den Humor eines Douglas Adams).
Du reist durch Zeit und Raum und Dimensionen, du beobachtest, wie der Planet unterhalb deiner Umlaufbahn Umfang und Form verändert, mal ein totes Feld, mal ein exlodierendes Etwas, eine gelbe Sonne, eine rote Sonne, eine pinkfabene Sonne, ein Teepott, eine zerschmetterte Tasse, ein Riesenauge, und so viel mehr. Während die verrückten Bilder vorbeigleiten, hören sie lange Zeit nicht auf, sehr unterhaltsam zu sein, aber schließlich werden sie doch immer weniger spassig. Endspiel. Du bist einigermassen erschöpft, und möchtest, dass alles vorbei ist.
In diesem Moment berührt das Spiel seine eigene absurdistische Wahrheit: du wirst nie verstehen, was du siehst, das Universum ist komplett verrückt, und es wird nie Sinn machen, du kannst bestenfalls lernen, es zu ertragen – willkommen im Café der Existenzialisten! (Ich werde dir hier nicht preisgeben, ob du es zurück zur Erde schaffst, weil das schlichtweg nicht der Punkt ist.)