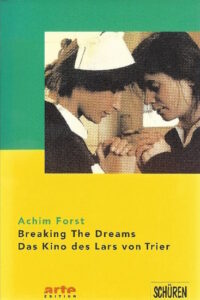Ja, weil alle Regisseure Manipulatoren sind. Sie versuchen uns Zuschauer durch ihre handwerklichen und künstlerischen Fähigkeiten dazu zu bringen, in ihren Filmen die Welt so zu sehen, wie sie wollen. Das misslingt schlechten Regisseuren und in schlechten Filmen. In mittelmäßigen Filmen kann es funktionieren, wenn sich Zuschauer und Kritiker mit Wohlwollen auf die Manipulation einlassen, obwohl sie sie durchschauen. Und es kann auf so ungewöhnliche Weise gelingen wie in „Breaking the Waves“, bei dem Kritiker (mehr als das Publikum) die Manipulation erkennen, benennen, sich zum Teil dagegen wehren und ihr am Ende trotzdem nicht entziehen können.
aus Achim Forst: „Breaking The Dreams – Das Kino des Lars von Trier“, Schüren 1998, ISBN: 3-89472-309-2
Früher, als ich anfing, den Weg des Film-Studierens zu beschreiten, durch etliche Kinobesuche und exzessives Studium von Filmkunst in den eigenen vier Wänden sowie dann auch mit Hilfe von Seminaren im Stuttgarter Filmhaus (wofür ich oftmals den nachmittäglichen Sportunterricht auf dem Weg zum Abitur schwänzte), war Lars von Trier einer der prägendsten Regisseure für mich, nicht zuletzt aufgrund seiner „Europa-Trilogie“, deren erster Teil, „Element of Crime“ aus dem Jahr 1984 einer bekannten deutschen Band zu ihrem Namen verhalf und deren dritter Teil, „Europa“ (1991), viele Jahre lang „Lieblingsfilm“ meiner persönlichen Bestenliste war. Mein erstes Praktikum nach dem Abitur machte ich dann auch am Stuttgarter Filmhaus, als einer der Mitarbeitenden am baden-württembergischen Filmfestival „Filmschau Stuttgart“. Als Abschlussgeschenk bekam ich vom Festivalleiter, damals ein junger Mann von stolzen 27 Jahren, das oben zitierte Buch, da er wie ich damals „Fan“ von Lars von Triers Schaffen war.
Mit „Breaking the Waves“ (auch angeregt durch Erfahrungen bei der Produktion der Serie „Riget“/ „Geister“) begann in Triers Schaffen eine neue Phase, die sich u.a. darin äußerte, dass er den Schauspielern mehr Raum geben und weniger exzessiv die technische Perfektion ausstellen wollte, für die er damals bekannt war. Für „Europa“ hatte er im Cannes-Wettbewerb drei Preise bekommen – den Sonderpreis der Jury, den „Technik Grand Prix“ und einen Preis für den besten künstlerischen Beitrag – und hatte den Ruf eines sehr technischen, verkopften Kunst-Filmemachers, dessen Filme zwar Bewunderung ernteten und Eindruck hinterließen, doch wollte er daraufhin auch als Autorenfilmer eines emotionalen, einnehmenden Publikumskinos eine größere Zuschauerschar erreichen und als Schauspieler-Regisseur respektiert werden. Lange hatte er wohl eher großen Respekt bis fast Angst vor Schauspieler/innen, vermutlich weil sie ihm nicht so kontrollierbar schienen wie der ganze Technikapparat, das Zitieren der Filmgeschichte und die Filmsprache, deren Anwendung er sich damals bereits bis zur Perfektion angeeignet hatte – wie man anhand von „Europa“ deutlich sehen kann: Der Film ist gleichermaßen Hitchock-Hommage (sowohl was den perfekten Einsatz von Thrillerelementen in manipulativer Hitchcock-Tradition betrifft, als auch im Hinblick auf die extrem komplexe, teils bis in Experimentalfilm-Aspekte hineinreichende Filmsprache) wie intellektuell-distanzierende Befragung dieser ganzen Referenzen, Erzählmittel und Geschichte (der Filmgeschichte wie auch der mitteleuropäischen Geschichte am Ende des Zweiten Weltkriegs). Zur Erinnerung: Hitchcock hat ja mit Truffaut ein ganzes Buch lang über die Manipulationsarbeit des Filmregisseurs gesprochen.
(links „Europa“, rechts „Element of Crime“ )
Natürlich – darf man hier einwerfen – stand Lars von Trier an diesem Punkt seiner Laufbahn keinesfalls der Sinn, zu einem typischen Illusionskino überzugehen, welches auf einmal all die intellektuellen und selbstreflexiven Aspekte seiner künstlerischen Position in die Tonne treten oder verraten würde, nur um sich einer mainstreamigen Traumfabrikation oder Märchenerzählerei (etwa in Form der klassischen Filmgenres) zu Unterhaltungszwecken zuzuwenden. Er musste also einen raffinierten Mittelweg finden, der ihm beides zugleich ermöglichte.
Mit „Breaking the Waves“, das gleichermaßen Melodram wie Melodram-Sezierung ist, gelang Lars von Trier der angestrebte Sprung zum großen Publikum, und der Film war zugleich ein weiterer heißer Kandidat für die Goldene Palme, musste sich dann aber (noch einmal) mit dem „zweiten Preis“, dem Großen Preis der Jury zufriedengeben. Bekommen hat Trier die Palme dann erst mit seinem übernächsten Film, „Dancer in the Dark“, dem man eigentlich vor allem ankreiden kann, dass er das Erfolgsrezept von „Breaking the Waves“ noch einmal, mit etwas anderen Gewürzen (etwa mit miniDV statt mit 35mm und mit Musicalszenen als Verfremdungseffekt), gekonnt aufkocht – und kaum mehr als eine geschickte Variation darstellt, zumal eine letztlich weniger zwingende.
Als ich „Breaking the Waves“ damals beim Kinostart im Kino in Stuttgart sah, war ich gleichermaßen begeistert wie irritiert, ebenso emotional mitgenommen wie auch verärgert – und so scheint es wirklich dem größten Teil der Besucher aller Trier-Filme zu gehen. Ich erinnere mich, welche unglaubliche Wirkung der Film damals in der Filmwelt hatte und wie er sehr viel diskutiert wurde. Und die Musik, die in diesen sehr artifiziellen, Brecht’schen Kapitelbildern zum Einsatz kommt und den Zuschauer ebenso brüsk aus der emotionalen Handlung herausreißt wie ihm direkt ankündigt, was nun als nächstes geschehen wird, hat mich (wahrscheinlich auch, weil ich die durch die Generation meiner Eltern von Kind auf kannte) nachhaltig berührt und ist mir immer stark in Erinnerung geblieben. Ein weiteres, deutliches Element zum Durchbrechen der Vierten Wand sind die regelmäßigen Blicke der Hauptfigur Bess bzw. der Hauptdarstellerin Emily Watson direkt in die Kamera. Als Filmstudent oder Schauspieler/in lernt man früh, dass man dies in jedem Fall vermeiden soll es sei denn, man will die Illusion und Identifikation (unter-)brechen und den Zuschauer in seinem Sitz gewahr werden lassen, dass er hier ja nur ein Schauspiel zu sehen bekommt, eine eigens für ihn mühsam aufgebaute Illusion einer anderen Welt oder Realität. Die Zuschauereffekte des erzählerischen Mittels des Blicks direkt in die Kamera sind, für den Erzähler, schwer kontrollierbar; zumeist wird der sich in seiner Außenposition sicher wähnende Zuschauende sich dieser Position bewusst, vielleicht sogar frustriert darüber, möglicherweise erleichtert, eventuell aber auch verärgert über das Ärgerliche, Anstrengende, Alberne oder hanebüchen Ausgedachte, was ihm gerade dargeboten wird; in gewisser Weise demonstriert der Erzähler – hier: der Regisseur – seinem Publikum, dass es ihm auf den Leim gegangen ist, und er macht diese Manipulation deutlich.
In einem Essay (Seminararbeit) über die Kapitelbilder in „Breaking the Waves“ greift Kathi Hofmann diesen V-Effekt auch auf:
Außerdem schreibt [Manfred Pfister] dieser „Form der Episierung eine anti-illusionistische Funktion“ zu, die eine Identifikation oder Einfühlung des Rezipienten in die Figuren erschwert und somit eine distanzierte, kritische Haltung begünstigt. Das vermittelnde Kommunikationssystem erlaubt überdies eine „direktere Steuerung des Rezipienten, die der kritisch-didaktischen Intention entgegenkommt.“
Ich erinnere mich gut, wie wir an der Filmakademie in einem Kameraseminar bei Reinhold Vorschneider die extrem konstruierte Kameraarbeit von Lars von Triers Filmen jener Zeit auseinander genommen haben – um uns zu vergegenwärtigen, dass dieser Stil keineswegs Ergebnis einer dokumentarischen, spontanen Herangehensweise ist, sondern auch diese „Effekte des Dokumentarischen“ [Ich glaube sogar, das dreiwöchige Seminar trug diesen Titel, zumal wir alle im Praxisteil, dem Drehen von Kurzfilmen auf Zelluloid verschiedenste solcherlei Erzählmittel austesteten.], des Zufälligen sehr überlegt als raffinierte Mittel geplant und eingesetzt werden. Trier bemühte sich in diesen Filmen in allerlei Hinsicht, die Illusion eines vermeintlich nicht geplanten, nicht beherrschten Geschehens aufzubauen (siehe auch: „Idioten“, „Dogville“ usw.), um so den Zuschauer zu suggerieren, dass dies alles „echt emotional“ wäre – nur um diese Illusion dann immer wieder zuverlässig zu zerstören. Letztlich hat er genau dies seit damals immer wieder recht ähnlich weitergeführt, mal stark variiert („Nymphomaniac“, „The Boss of it all“), oftmals eben aber auch unmittelbar an das anknüpfend, was er mit „Breaking the Waves“ erstmals so geschickt erarbeitet hatte. Bspw. findet man in „Melancholia“ und auch „Antichrist“ wiederum die gleiche Handkamera-Ästhetik, verbunden mit einer scheinbar emotional in Auflösung befindlichen Hauptfigur und Lebenssituation – und dann bricht er immer wieder die vierte Wand, um uns zu zeigen: Lasst euch nicht hinters Licht führen, denkt nach, ob ihr glauben wollt, was ich euch hier an Haarsträubendem auftische! Alle Trier-Filme haben neben der extrem konstruierten, pseudo-realistischen Handlung immer diese formale Ebene, in der das Erzählte am laufenden Band reflektiert, hinterfragt, in Frage gestellt, gebrochen, oftmals sogar komplett aufgelöst wird.
Das Verrückte ist, dass, selbst wenn diese Films noch so unfassbar offensichtlich konstruiert sind, streng genommen nicht einmal mehr glaubwürdige, realistische Figuren haben, sondern sogar ausgestellte Figuren-Typen vorführen, ein frappierend großer Teil des Publikums dennoch emotional mitgeht, also mit den Figuren leidet (meist sind es bekanntlich Frauenfiguren). Der ganze Gag ist ja schließlich, dass die Filme genau deswegen erfolgreich sind – obwohl jedem mitdenkenden Zuschauer ja sowas von klar ist, dass uns eine total konstruierte bis hanebüchne Geschichte aufgetischt wird. Ich bin mittlerweile sicher, dass genau das der Punkt ist, an dem sich Triers Publikum in die Bewunderer und die Verärgerten scheidet; er führt uns immer wieder vor, wie einfach wir doch manipulierbar sind.
Trier ist freilich nicht der einzige Autorenfilmer, der Wert auf eine solche selbstreflexive Haltung legt; der Normalfall ist das Sichtbarmachen der Manipulation im Kino und in Serien keineswegs. Michael Haneke etwa betonte häufig, dass er es wichtig findet, dass sein Publikum in jedem seiner Filme die Gelegenheit bekommt, sich bewusst zu werden, dass ihm eine Fiktion präsentiert wird; man findet solche Elemente in allen seinen Filmen, markantestes Beispiel sind sicherlich die Momente in „Funny Games“, wenn die quälenden und mordenden jungen Männer den weiteren Handlungsverlauf besprechen, sich verschwörerisch ans Publikum wenden und in einer Szene sogar mit Hilfe einer Fernbedienung die Filmhandlung zurückspulen, um sich beim zweiten Mal anders verhalten können. RW Fassbinder stellte die Brechtsche Distanz unter anderem durch artifizielle, offensichtlich gestelzte, nicht naturalistische Theatersprache her, in Christian Petzolds und Atom Egoyans Filmen kommen beispielsweise Bilder von Überwachungs- bzw. Videokameras zum Einsatz, auch sprechen die Figuren ihr Spielen oder die Rollen, die sie verkörpern, oft selbst an. Besonders raffiniert ist das Deutlichmachen des Manipulierens von audiovisuellen Erzählungen aktuell in Christopher Nolans „Oppenheimer“ zu sehen. Letztlich würde ich sogar so weit gehen zu sagen, dass genau dies zentrales Thema des Films ist: Aufzuzeigen, dass jede Meinung, jedes Urteil, jede Geschichte, jede Nacherzählung oder Bebilderung geschichtlicher Ereignisse, die uns die audiovisuellen Medien (bzw. die dahinter steckenden Erzählenden) glauben machen wollen, nichts anderes als eine von bestimmten Interessen manipulierte ist.