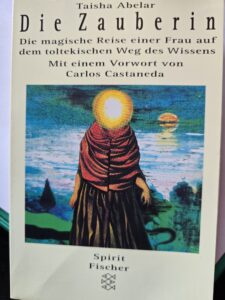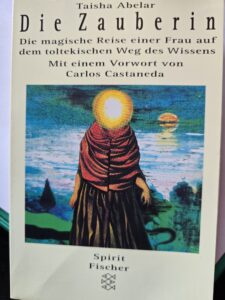
Eines der letzten Abenteuer, die man erleben kann, ist das Ausräumen der eigenen Bibliothek, was unter Umständen Jahre in Anspruch nimmt, weil man sich ständig in den Schwarten festliest, die man eigentlich weggeben wollte. Und viel Spass mit Fossilien aus grauer Vorzeit hat, die einem plötzlich besser gefallen als zu Zeiten der Anschaffung. Oder andersrum …Donne é mobile..
Also über Ostern oben Genanntes vom Staube befreit und sich vertieft und nein … es kam kein déja vu, keine Neugier auf Erlebnisse mit magic mushrooms und keine Freude über weise Sprüche eines schamanischen Lehrers mit ansonsten schlechten Manieren auf, da groovte nichts so wie früher. Genau wie mit dem heutigen Gras, das knallt auch nicht mehr, trotz erhöhtem THC-Gehalt.
Das Buch ist die weibliche Antwort auf Castaneda – der hat auch das Vorwort geschrieben – und sowohl vom Cover als auch vom Inhalt her eigentlich eine Kopie davon, nur dass Don Juan hier eine Donna ist. Das verspräche interessant zu werden, leider stellt sich nach den ersten hundert Seiten aber sukzessive eher etwas wie Überdruss ein und man liest nur noch quer und diagonal und sucht auf den letzten Seiten vergeblich nach der Pointe.
Gut – rekapitulieren wir: Die Jugendbewegung in den westeuropäischen Ländern war am Abflauen, man hätte sie als gescheitert betrachten können; der Vietnamkrieg tobte ungehindert weiter, in Deutschland wurden die revoltierenden Studenten kriminalisiert und per neu eingebrachter Gesetze diszipliniert, bezüglich der Rassentrennung ging auch nichts voran, nur die Frauen arbeiteten unbeirrt weiter an ihrer Befreiung, die hatten sich den langen Atem offenbar schon vorher antrainiert. Wer alle 4 Wochen menstruiert und tierische Bauchschmerzen hat lernt Dinge auszusitzen. Diese Bewegung hatte auch den bei weitem besten outcome zu verzeichnen.
Für mich endete die Jugendrevolte im Juli 1977, als ich spätnachts auf dem Unicampus in einem riesigen Zelt voller leerer Ami-Schlafsäcke lag, um hungerstreikende Kommilitonen zu bewachen und zu unterstützen. (Wir hatten durchaus etwas gegen Amis und Armys, aber ihre Schlafsäcke und Parkas liebten wir. Palästinensertücher auch). Soviel zum alternativen Geschmack und seinem Faible für Uniformierung – eine Fundgrube für Warenästheten. Und für die Fähigkeit einer Generation das auszublenden was nicht ins Raster passte und manchmal peinliche Codes zu entwickeln. Und peinliche Konstrukte von Realität zu entwickeln.
Der Unirektor und die Spektabilitäten hatten beschlossen, uns nicht zu vertreiben (Ordnungsrecht!), sondern die Sache gemütlich auszusitzen, vermutlich wussten sie schon, wie es ausgehen würde und hatten recht damit. Während es eine zeitlang auf dem Campus vor dem ehrwürdigen Gebäude von Hungernden, Solidarischen und Solidaritätskundgebungen nur so wimmelte, wurden diese im Lauf des Sommers immer weniger (Semesterferien, da fuhr man erst zu den Eltern zum Durchfüttern, Ausschlafen und Wäschewaschenlassen und dann trampte man sauber und satt nach Griechenland), da war’s mit der proletarischen Revolution dann gerade mal nicht so eilig – und in dieser Nacht erwachte ich plötzlich im Zelt und fand mich mutterseelenalleine, sogar die professionellen Hungerer waren verschwunden. Gegenüber dräute finster der Stadtpark, den man als Frau in den Stunden der Dunkelheit auch besser mied und ich gruselte mich entsetzlich. Gottlob erschien plötzlich ein Trupp leicht angeschickerter junger Touristen, die sich mein Leid anhörten, mir einen Burger spendierten, sich dann die Schlafsäcke schnappten, die Nacht im Zelt verbrachten und das Ganze unter Abenteuer verbuchten. In dieser Nacht, die ich dann in sicherer Hut schlafend und ohne Magenknurren verbrachte, wurde mir klar, dass die Bewegung nicht nur in Würzburg sondern in toto vorbei war und ich lernte etwas über das Durchhaltevermögen junger Revolutionäre und ihre Ego-Trips.
Aber was jetzt? Wohin mit dem überschiessenden Potential in unseren Cortexen neue Welten zu entwerfen?? Oder heissts Cortices?? Wurscht! Latein…angestaubter bildungsbürgerlicher Scheiss..
Freilich konstituierte sich Neues: Die Hippies (aus denen später dann löbliche Dinge wie die Anti-Atom und die Friedensbewegung erwuchsen) und die, die mit ihnen sympathisierten, machten sich auf die Reise nach innen, das war offenbar nicht so hart wie die vorherigen Agitationsaufgaben – vor allem musste man nicht so früh aufstehen, um Flugblätter an die Arbeiter zu verteilen, die sich zur Frühschicht schleppten und die Dinger sowieso gleich wegschmissen. („Und die kannten uns viel besser als wir sie je kannten …“ sang Degenhardt zu dieser Zeit zum Thema Arbeiter-Studenten-pairing).
Offenbar wollten sie aber nicht allein nach innen reisen – die vaterlose Generation die alles was nach Führung roch angeblich verabscheute aber trotzdem zuliess dass autoritäre linke Gurus in ihren Reihen heranwuchsen ( mit Mädels die ihnen die Flugblätter tippten bevor sie den Machos den Rücken kehrten, die Schreibmaschine wegschmissen und in eine Frauenselbsterfahrungsgruppe abwanderten) bekam offenbar Sehnsucht nach neuen Führungspersönlichkeiten und machte sich auf zu den spirituellen Lehrern. Die Beatles sassen im Schneidersitz bei einem Yogi, in Poona bereitete sich auch Entsprechendes vor und ja … ich gebe zu, mich auch einige Zeit in einem Ashram herumgetrieben zu haben. Man profitiert durchaus – mir wird beim Sufi-Dance nicht mehr schwindlig und von dort kommen meine besten vegetarischen Kochrezepte – kennt jemand Auberginenrollmops? Das Klo konnte man nicht absperren, aber das durfte man in den Kommunen auch nicht. Wir wollten ja alles vergesellschaften, offenbar also auch Ausscheidungsvorgänge.Eine etwas degoutante Seite der Bewegung…
Der Buchmarkt begann in immer höherer Frequenz Geschichten von Reisen aus spirituellen Gründen, Initiationen und Erleuchtungen zu produzieren, die zum Teil so unwahrscheinlich klangen, dass ich schon damals vermutete, dass sich einige Verlage mit einem Häufchen von Ethnologie-Studenten, die als Ghostwriter fungierten, eine goldene Nase verdienten. Okay, mit Hilfe von magic mushrooms und anderen Halluzinogenen kann man einiges erleben, aber diese Geschichten ähnelten sich wie ein Ei dem anderen, als hätte sie dieselbe KI geschrieben: Akademisch gebildeter Westler folgt einer Art von Ruf oder sonderbaren Zeichen und macht sich auf zu den Indianern (oder wahlweise Lamas oder buddhistischen Mönchen), findet eine/n Lehrer/in und wird von da ab erst einmal schlecht behandelt, mit seiner zivilisatorischen Entfremdung und Unwissenheit konfrontiert, mit Verachtung bedacht und gibt gegenüber seinem naturbelassenen Lehrer, der ihn gerne hängen oder auflaufen lässt, eine ziemlich unglückliche Figur ab, bis er sich als braver Lehrling erweist und zumindest in den Gesellenstatus erhoben wird, falls es dergleichen bei Schamanen überhaupt gibt. Und die Ahnen dem auch zustimmen.
Gemeinsamer Lehrer statt gemeinsamer Feind – was für ein Decrescendo!

Carlos Castaneda erfreute uns über Jahrzehnte mit der Schilderung eines protrahierten Pas de Deux mit seinem Lehrer Don Juan und viele empfanden diese als Offenbarung und machten sich ihrerseits auf den Weg – auch Frauen begaben sich in sadomasochistische Beziehungsmuster mit notorisch schlechtgelaunten Schamaninnen.
Heute werden die meisten dieser mässig spannenden Ergüsse für Fiktion gehalten und hielten Nachforschungen nicht stand. Wie auch immer – auf 200 Seiten sagt also Schamane/in seltsame Dinge, der Adept/in befolgt seltsame Anweisungen und erlebt Seltsames mit seinem Körper und seiner Wahrnehmung. Der geneigte Leser, am Kennenlernen der Anderswelt sonst durchaus interessiert, ermüdet rasch. Irgendwann scheint der Schüler dann „fertig“ zu sein, der Lehrer ist zufrieden und dann endet das Buch mit der Rückkehr des solchermassen Erwachten in die zivilisierte Welt mit Elektrizität und fliessendem Wasser, wo er sich künftig wahrscheinlich fühlt wie Gregor Samsa.
Wie auch immer – es greift nicht mehr, zumindest nicht bei mir. Was mir dabei etwas aufstösst, ist diese manische Führersuche einer Generation, die expressis verbis jegliche Führung verabscheute, aber Che Guevara, Dubcek, Castro, Marx, Lenin, Walesa etc über das Bett gepinnt hatte als Logo, dass da ein revolutionärer Geist schlief oder anderweitiges tat. Bei den Mädels hing Che Guevara, weil der am besten aussah, da mischten sich auch erotische Komponenten in den Führerkult. Und bei einem strammen Marxisten/Leninisten hing sogar Enver Hodscha, und der sah noch nicht mal gut aus. Der Hodscha, nicht der Marxist. Der übrigens auch nicht.
Was mir weiter aufstösst, ist diese hohe Bereitschaft, sich an die Hand nehmen, in eine „neue Welt“ einführen zu lassen und dabei fortlaufende Demütigungen in Kauf zu nehmen, damit dieses Ausbildungsverhältnis nicht vorzeitig beendet wird und sich mit diesen Nackenschlägen auch noch zu identifizieren und sich am Ende selbst für einen von seinen Wurzeln entfremdeten und hirnlastigen Trottel zu halten. So jemand befreit keine unterdrückten Massen, der knabbert noch schwer an der eigenen Abhängigkeit und diversen transgenerationalen Traumata und seien es nur die der schwarzen Pädagogik. Und ja … ich habe auf einem Kongress über alternative Medizin im schönen Garmisch auch eine schamanische Initiation von einen echten Schamanen über mich ergehen lassen und einen stundenlangen „Reinigungstanz“ mit Rassel vollführt – am folgenden Tag hab ich mich stundenlang übergeben, das war wohl die Reinigung. Was für eine Metaphorik! Oder die Salmonellen vom Büffet. Dann bekam ich einen Namen, in der Anderswelt heisse ich jetzt Night Cloud. Die Ahnen waren einverstanden. Möchte ich ihnen auch geraten haben. Aber ich schwöre, dass das schon sehr lange her ist.
Fazit: Leute, räumt Eure Bücherregale aus, Ihr lernt was.