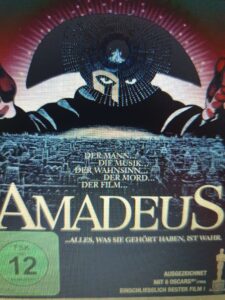Dieser Film will es uns glauben machen …
Amadeus (USA, 1984) von Miloš Forman
frei nach einem Theaterstück von Peter Shaffer (1979)
Etliche Oscars und Golden Globes
Primo:
Was man von diesem Film nicht verlangen darf, ist historische Genauigkeit. Das darf man aber auch nicht von älteren Produktionen zum Thema Mozart verlangen, in denen man uns eine stark idealisiert-sterile Version des Komponisten aus dem Dullijöh-Wien des 18. Jahrhunderts ins Grosshirn implantieren wollte wie etwa bei „Wen die Götter lieben“ von 1942. Der hat gereicht – etwas für schwärmerische Teenies jeglichen Alters und der verdiente Hans Holt eignet sich natürlich prima für dergleichen Weaner Schmäh mit Zuckerln und Nockerln und Busserln, daneben die ebenso verdiente Winnie Markus als sein geplagtes „Stanzerl“. Hat er jetzt so auch wieder nicht verdient, manche Leute sind eben mit ihren Feinden besser dran als mit ihren Freunden. Darauf ein Venusbrüsterl!
Forman ging es weder um ein Biopic noch um realistische Figurenzeichnung, sondern eher um eine zunächst flotte Nummernrevue, die dann unversehens in Tragische kippt.
Secundo:
Wie bereits das Filmcover verrät, geht es nicht um die Darstellung des Lebens von Mozart, sondern um ein Psychodrama, eine innere Bühne und Schattenwelt, in der die individuellen Dämonen ihr Menuett tanzen, die Welt der Introjekte, wie wir Trüffelschweine von Freuds Gnaden sagen würden. Der Regisseur schafft es, einen spannenden Krimi um den Komponisten und seinen chronischen Widersacher zu modellieren, das Ganze im psychologischen Spannungsbogen Genialität-Mittelmässigkeit aufgespannt, und das Pandämonium der Gefühle zu zeigen, die einen zum ewigen Durchschnitt Verurteilten umtreiben, wenn er auf sein Ich-Ideal trifft und ihm nicht aus dem Wege gehen kann. Diese Rahmenhandlung bietet hinreichend Halt für ein ansonsten brodelndes Gebräu.
Wir sehen Mozart also nicht als reale Person, sondern vielfach gebrochen, verfärbt (das auch im Wortsinne) und entwertet durch das Auge des neidischen und missgünstigen Hofkomponisten Salieri, der ihm im realen Leben gar nicht mal so sehr feindselig gegenüberstand. Realiter hatte jeder von beiden das, was der andere auch gern gehabt hätte – Mozart das Genie und die Gunst der Damenwelt, Salieri seine feste Anstellung bei Hofe und sein gutbürgerliches Auskommen; man liess sich am Leben und bei Cosí fan tutte arbeitete man sogar gemeinsam am Libretto.
In diesem Film ist es anders – hinter den Konventionen, Brokatvorhängen, Schabracken und Paravents brodelt es vor Intrigen und Ränkespielen und Salieri leidet so sehr unter seiner Mittelmässigkeit und seinem schwer gebeutelten Narzissmus (und letztlich an der Schuld, den Tod seines Ideals verursacht zu haben), dass er versucht, sich die Kehle durchzuschneiden, in einer Heilanstalt landet und im Rückblick einem Priester – und damit uns – die Geschichte seines Widersachers – eines wie er sagte „obszönen Clowns, den Gott zu seinem Gefäss erwählt hatte“ – zu erzählen. Der Blick auf Mozart ist also stets subjektiv durch den Neider koloriert.
Die geschickte Sympathielenkung des Regisseurs verhindert jedoch die Demontage des Idols und beraubt Mozart nicht des Wohlwollens des Publikums – so wie man ihm auch die Sympathie in der Realität nicht versagte, obwohl er ausgesprochen unanständige Briefe an sein Bäsle geschrieben hat – allerdings ein Klacks gegen das, was uns heute auf Instagram entgegenschwappt. Und mit der ehelichen Treue nahm er’s ja auch nicht so genau, ging wohl sogar mit der eigenen Schwägerin fremd – noch dümmer kann man’s gar nicht anfangen, by the way, das kriegt doch jede Ehefrau sofort raus.
Er wirkt unter dem Mikroskop des Nichtwohlwollenden zwar wirklich wie ein herumkaspernder ADHS-Geschlagener (seine Frau gibt dazu das weibliche Tussipendant); seltsam bunt eingefärbte Perücken erzeugen eine Assoziation an die Punkszene – ein junger Rebell im 18. Jahrhundert, dabei aber auch lausbubenhaft sympathisch und merkwürdig deplaciert innmitten des altbackenen Rokoko-Dekors. Tom Hulce stellt diese Dichotomie meisterhaft dar in einer bilderreiche Reise eines chronisch Unbekümmerten – ein Bisschen Parzifal, ein bisschen Simplicissimus – aber niemals wirklich Gebrochenen bis hin zu seinem frühen Verglühen.
Salieri schafft es nicht, Mozart dem Publikum zu vermiesepetern, man merkt, dass er ihn im Grunde auch mag – Forman hat dergleichen sowieso nicht vor und es gelingt ihm, die Szenen gut auszubalancieren – in einer davon stellt Mozart Salieri vor dem Kaiser bloss, indem er einen von Salieri komponierten kleinen und etwas drögen Marsch spontan am Hammerklavier umwandelt und wir erleben so die Entstehung der Arie des Figaro an Cherubino „Nun vergiss leises Flehn“, einer der Top Ten, falls es damals schon eine Hitparade gegeben hätte. Der Kaiser ist entzückt, wir auch und Salieri tut uns leid. Eine menage à trois – zum Rivalisieren gehört meist auch ein Dritter, um dessen Gunst rivalisiert wird, manche schaffen’s aber auch zu zweit, da geht’s dann mehr um Selbsterhöhung als um Gunstgewinnung, da bleibt man innerhalb der narzisstischen Pathologie und kommt nicht bis zu Ödipus – fallls man da je hinwollte.
Damit wäre die Leinwand für das Drama aufgespannt – das komplexe Geschehen einer lebenslang drückenden und dräuenden Vaterimago auf einen Sohn, dem wenig Luft gelassen wird eigene Ziele zu entwickeln und des Lebens Freuden zu geniessen – was er trotzdem redlich versuchte.
Salieri hadert mit Gottvater, der ihm Mozart zugesellt hatte, um ihm täglich seine Mittelmässigkeit vor Augen zu führen – das ganze anmutend wie eine Art Geschwistereifersucht, die letztlich das Verschwinden des Rivalen wünscht und er grollt dem Landesvater, der den begabten Clown offensichtlich bevorzugt, ein zurückgesetzter Bruder par excellence (der reale Salieri hatte wirklich einen sehr begabten älteren Bruder – auch nicht leicht für einen strebsamen Jungen).
Mozarts Leben wird überschattet vom ehrgeizigen und ihn zu höchster Leistung pushenden, delegierenden (und vielleicht insgeheim doch neidischen Vater, aber bleiben wir im Reiche der Fiktion) und später dem unzufriedenen und drohenden Patriarchen, der wohl lebenslang seine Pranke nicht von ihm abzog und ihm seine Heirat mit einer einfachen Bürgerstochter und seinen aufwendigen und ausschweifenden Lebensstil schwer verübelte.
Bedrohliche und strafende Väterlichkeit musikalisch düster und treffend darzustellen, war Mozarts Spezialität – den Auftritt des strafenden Comturs unter düsterster Musik in Don Giovanni, den mörderischen und eifersüchtigen Bassa Selim, Graf Almaviva, der alle mit dem Tode bestrafen wollte, die lediglich das gleiche wollten, wie er selbst (nämlich möglichst viele Frauen ins Heu kriegen, aber es gibt eben das Jus primae noctis für den Souverän, das muss ausgeübt werden und quod licet jovi …), Idomeneo, der bereit war seinen Sohn als Opfergabe für den eingeschnappten Gottvater Neptun zu töten – Vaterfiguren verlangen viel und strafen drakonisch und den Don Giovanni holt unter Zuhilfenahme des Comturs letztlich auch noch der Teufel wegen seiner Vielweiberei.
Auf diesem Parkett kannte sich Mozart gut aus. Er beteiligte sich an der Herstellung der Libretti und fand die richtige musikalische Tönung für grollende Patriarchen, die es zu besänftigen galt. Ein Lebensthema und hier auch sein Tod. In der Realität besuchte Mozart der „schwarze Gast“ und forderte ein Requiem als Auftragsarbeit für seinen Herrn, dessen Namen er nicht nennen durfte – eine wohl real stattgefundene und unheimliche Inszenierung, die beim kränkelnden Mozart ihre Wirkung nicht verfehlte. Dahinter steckte ein wohlhabender Adliger, der um Mozarts Erkrankung wusste und hoffte nach seinem Tod die Komposition als die eigene ausgeben zu können.
Hier im Film zieht natürlich Salieri die Strippen, der ihn als schwarzer Gast besucht – im Kostüm von Leopold Mozart, getragen auf dem letzten Maskenfest vor seinem Tod. Mozart solle mit dem Requiem bald beginnen – so lautet der mit hohler Stimme erteilte Auftrag – er habe nur noch wenig Zeit. Ein Charon, der ankündigt dass die Segel bereits gesetzt wären. Mozart versteht sehr wohl wohin die Fahrt gehen soll.
Ein bisschen Geschichtsklitterung eben.
Der über die unheimliche Begegnung zutiefst erschrockene Mozart beginnt das Requiem zu schreiben, Salieri hilft ihm dabei, in der Hoffnung das Manuskript klauen und ebenfalls das Werk später als sein eigenes ausgeben zu können. Trotz aller bösen Vorhaben scheint Salieri plötzlich angerührt vom Kampf des Sterbenden, der dem Tod sein letztes Werk abringen muss, der Film wechselt vom Fortissimo ins Adagio; es entsteht in diesen Szenen eine seltsam schwebende Nähe zwischen beiden, ein neuer Klang, ein Berühren, eine Ahnung davon, was zwischen ihnen hätte möglich sein können. Ein Verbundensein im primordialen Raum der Musik.
Der Plan, den väterlichen Schatten auf Mozarts Leben virulent werden zu lassen und ihn in seinem Lebenswillen zu schwächen, bis er sozusagen einen Voodoo-Tod erleidet – bei diesem stirbt man ohne weitere Gründe aufgrund des „Fluchs“, also der blossen Vorhersage, ein psychogener Tod – heissts zumindest, realiter sind dabei wohl irgendwelche raffiniert applizierten Gifte im Spiel, die Naturvölker sind ja auch nicht blöd – gelingt, allerdings findet die dazukommende Constanze das Skript und nimmt es in Verwahrung. Bingo!
Danach geht sich Salieri selbst an die Gurgel.
Das Ganze immer wieder mit humorigen und ironischen Brechungen konstruiert und ohne die liebenswerten Figuren über die Maßen zu verzerren oder ins Lächerliche zu ziehen – und am Ende findet sich der Zuschauer im Sessel wieder beim Meditieren über das eigene Ich-Ideal und dessen Ansprüche und ob es eine derart bewundernde Hassliebe überhaupt gibt und wie sie sich wohl anfühlt. Somit ist der Film auch eine Studie über die Klebkräfte von Hassbindungen (Liebe endet oft genug zu früh – Hass in singulärer und kollektiver Form selten und wenn dann zu spät, wer’s nicht glaubt, schaue kurz in die Tageszeitung ) und zum Schluss sei Giordano Bruno zitiert: „Ist’s auch nicht Wahrheit, ist’s doch schön erfunden.“
Und in der Ferne hört man Tom Hulce ein letztes Mal wiehern.
~ Fin ~