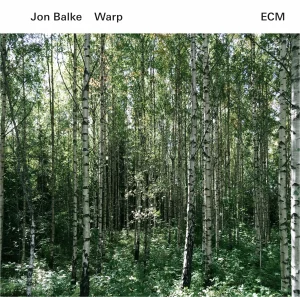“I wish I was flying!
I wish I was a bird!
Crossing oceans
Crossing cities
Crossing it all out!
I wish I was a surfer riding waves
I wish I was Bram Stoker paddling in the sea at Whitby
I wish I was a genius with ALL the answers“
Martina: Es hat mich erstaunt, als zweiten Track deiner letzten Ausgabe der Klanghorizonte die Titelmusik von Twin Peaks zu hören, komponiert von Angelo Badalamenti. Dafür hat es sicherlich mehrere Gründe gegeben. Der Beginn der Fernsehausstrahlung der Serie im Herbst 1991 auf RTL fällt etwa mit dem Beginn der Klanghorizonte zusammen. Wichtiger scheint mir die Reminiszenz an das Element des Unheimlichen, das sich wie ein roter Faden durch deine Musikauswahl zieht. Ich denke jetzt nur mal an einige meiner Klanghorizonte-Favoriten: Boards of Canada, Bark Psychosis, Bohren und Der Club of Gore und Labradford, aber auch an hörspielartige Tracks wie den Prolog und das Finale aus dem Horrorfilm The Fog von The Carpenter. Aber nicht nur die. Ich überlege, ob du je Musik aufgelegt hast, die auf einer subkutanen Ebene nicht unheimlich war. Zum Beispiel habe ich gerade eine Aufnahme einer Sendung vom Mai 2010 in der Hand, die ich nach einer Formulierung von dir so betitelt habe: „Glückshormone auf der Oberfläche, tiefe Nacht darunter.“ Warum ist dir das Unheimliche in den Klanghorizonten so zentral wichtig gewesen?
Michael: Das kommt nicht nur von den Gespenstergeschichten, die ich besonders in jungen Jahren liebte, von Poe oder Lovecraft. Nicht nur von uralten klassischen Kriminalromanen, von Conan Doyle, oder Simenon. Ungefähr 80 Prozent der Romane, die ich lese, sind Kriminalromane. Ist das nicht auch unheimlich!? Es war nie eine bewusste Entscheidung, dem Unheimlichen Platz zu geben, obwohl: ich liebte es, wenn sich in den Nachtstunden (anfangs waren es nur eine oder zwei, glaube ich) „seltsame Atmosphären“ ausbreiteten, in denen das Zusammenspiel von erhebender und dunkler Musik eine besondere Textur schuf: Emotionen sollten ihre klaren Zuteilungen verlieren, übliche Orientierungen abhanden kommen: Brian Enos Ambient Music war dafür ideal, „On Land“, „Music for Films“ (1978), „Apollo“ und Instrumentalstücke von „Another Green World“… diese Alben sind wohl die meist aufgelegten meiner Nächte gewesen. Mit den gesammelten Adagios von ECM. Und den Werken von Thomas Köner. John Zorn erzählte mir mal, wie sehr er „Pet Sounds“ von den Beach Boys liebte, vor allem, wegen all der Dunkelheiten unter heiteren, ausgelassenen Oberflächen. In den Klanghorizonten habe ich nie Unterhaltungsmusik gespielt. Die GEMA kodiert das falsch. Es ging um Storytelling, darum, um ein Feuer zu sitzen, zu erzählen, und zu lauschen. Und ich habe, für gewöhnlich, einen ziemlich guten Humor, bin kein finsterer Geselle.
Martina: Wie schwierig das „Sequencing“, also die Anordnung der Tracks ist, merkt man spätestens, wenn man es selbst versucht. Als ich noch Audiokassettenmixtapes gemacht habe, habe ich einmal für einen langjährigen guten Freund ein paar meiner liebsten aktuellen Stücke aus den Klanghorizonten zusammengestellt. Er beschwerte sich darüber, dass die Tracks keinen Zusammenhang ergäben. Das hat mich enttäuscht (Beides: Dass mir das Sequencing nicht gelang, und dass er so ablehnend reagiert hat.) Du hast zu deiner letzten Ausgabe der Klanghorizonte in einem Kommentar angemerkt, dass die Stimmung von Twin Peaks mit ihren Unheimlichkeiten für das Sequencing in deiner Sendung eine große Rolle gespielt hat. Inwiefern?
Michael: Ja, die Filmmusik von Angelo Badalamenti habe ich sehr oft aufgelegt. Wir haben damals, ich dachte es wäre 1989 schon losgegangen, egal… viele von uns haben sehnsüchtig gewartet auf jede neue Folge der Serie von David Lynch: sie hatte alles, eine spannende Story, vielschichtige Charaktere, femmes fatales, die von einem Abgrund zum nächsten lockten, Traumszenarien und Musikmotive, die diesen Sog der Bilder und Dialoge vertieften. Und als ich bei der Vorbereitung der letzten Nacht „Twin Peaks“ wieder mal von Anfang bis Ende hörte, war es noch leichter, aus etlichen vor-ausgewählten Stapeln von LPs und CDs die eine und andere Musik rauszupicken, die mithalf, einen perfekten Spannungsbogen für jede einzelne Stunde zu ermöglichen. Und viele Nächte waren mehrstimmig, in fast 32 Jahren waren ausser meiner noch 150 bis 250 andere Stimmen zu hören, Musiker, Komponisten, die mit O-Tönen ihre eigenen Stories beisteuerten.
Martina: An manche O-Töne erinnere ich mich wortwörtlich und von ihrem Rhythmus und Sound her. „We lived in an isolated house“, hieß es einmal zu einer Plattenaufnahme in Norwegen, ich weiß aber nicht, welche, aber ich würde die Stimme wiedererkennen. Und dann sprach der Interviewte über das gute Essen. Hat dich dein „Sequencing“ während der Nächte auch mal überrascht?
Michael: Schon, weil Dinge, die du dir vorstellst, mitunter anders rüberkommen wenn sie dann real geschehen, nachts. Zwei Beispiele. Da ist diese Sache mit den „Oldies“ – ich mag den Begriff überhaupt nicht. Und ich versuche, wann immer es geht, sog. „Oldies“ – aufgepasst, anstrengendes Fremdwort! – zu dekontextualisieren. Wenn ich solche Songs der Jahre 1965 bis 1975 spiele, die haufenweise Jukeboxgeschichte geschrieben haben, will ich sie aus dem Feld von Nostalgie und Regression rausholen. Wie in der letzten Nacht. Da lief in der ersten Stunde kurz vorm Ende eine Feldaufnahme von Chris Watson, von einer abgelegenen Insel, meilenweit von der Küste Northumberlands entfernt, eine ganze Zeit lang – ich blendete das Stück langsam aus, ein Moment Stille, und dann, aus dem Nichts, der großartigste Song, den Marc Bolan je geschrieben hat, Cosmic Dancer, über den schillernden Reigen des Lebens zwischen Geburt und Tod. Das ist existenzieller Stoff. Da klappte es mit dem „Sequencing“ perfekt. Das kommt ja fast wie ein Schock daher, ich mag solche „was-ist-denn-hier-los“-Momente.
An anderer Stelle habe ich mich selber ausgetrickst. In der ersten Stunde kam auch eine Komposition von Jon Balkes fantastischer CD „Warp“, eine von gefühlten fünfhundert ECM-Alben, die ich seit 1990 im Radio gespielt habe, wahrscheinlich noch mehr – ich hatte mir ein Stück daraus ausgesucht, in dem Piano, Elektronisches, und Sounds aus einem Freibad zu hören sind – und plötzlich, nichts dergleichen, vielmehr gesellen sich zum Klavier seltsame Gesänge eines alten Chors. Ich war so irritiert, dass ich dachte, eine andere Klangquelle wäre im Spiel, ich habe vielleicht vergessen eine CD zu stoppen – wenn du die Stunde hörst, merkst du, dass ich an einer Stelle die Lautstärke des Balke-Stückes runterregle, um zu hören, ob der Chor dann auch leiser wird. Ich war perplex, ein kleiner Blackout, der nachts manchmal passieren kann. Aber alles war gut. Es war nur nicht die perfekte Sequenz. Die Geräusche aus dem Schwimmbad wären besser gewesen. Dachte ich jedenfalls in dem Moment.
Martina: Ein weiterer zentraler Begriff, der deiner Musikauswahl zugrunde liegt, ist das Archaische. Nirgendwo habe ich das Wort so oft gehört wie in deinen Moderationen; in jüngster Zeit habe ich es allenfalls noch in Interviews mit Gary Snyder in dem inspirierenden Interviewband Landschaften des Bewusstseins gelesen. Das Archaische, das können Field Recordings sein, auch aus rätselhaften, unzugänglichen Regionen, echt oder elektronikverstärkt, aber auch ganz andere musikalische Sprachen als die nordamerikanisch-europäisch geprägten, die uns vertraut sind. „Rockmusik als archaisches Ritual“ – ich erinnere mich an diese Formulierung von dir zu dem Album „The Seer“ von Swans. In deinen letzten Klanghorizonten vom 18. Dezember stand das Archaische in der dritten Stunde im Mittelpunkt, es war die Stunde der „Weltmusik“ und der Adaption afrikanischer Klänge in unseren Kulturraum. Die Abteilung Archaik im Sinn einer afrikanischen Weltmusik ist zwar die kleinste in meinem Plattenschrank, dennoch erlebe ich die Wirkung als enorm und geradezu als bewusstseinserweiternd. Das schließt auch bedrohliche Gefühle mit ein. Vor einigen Jahren habe ich eine Woche in Kapstadt verbracht, bin einmal als einzige Weiße an einem sommerlichen Nachmittag durch eine belebte Hauptstraße gegangen – eine wichtige Erfahrung für mich. Archaische Musik berührt uns auf andere Art als Musik unserer Kultur, sie ist stärker in einer Welt des Unterbewussten angesiedelt, weil uns die kulturellen Zusammenhänge und die Worte dafür fehlen. Wie kam es, dass dir das Archaische in den Klanghorizonten immer ein wichtiges Anliegen gewesen ist?
Michael: Das Archaische ist an das Unheimliche gebunden, weitaus mehr als an fremde Ethnien. Es ist ein Lieblingsbegriff, dessen Konnotationen bei mir wohl sehr weit gehen. Vielleicht war es auch Quatsch, eine Marotte, dieses Wort so oft zu verwenden. So habe ich zum Beispiel einen intuitiven Zugang zu den „Roots“ des „Reggae“. Nyabhingi-Trommeln. Früher Marley. Lee Perry. Mir ist völlig unklar, warum ich mich diesen Klängen so nahe fühle. Das Album von Keith Hudson aus dem Jahr 1974, das ich in der „Weltmusik“-Stunde spielte, „Flesh Of My Skin, Blood Of My Blood“, berührt mich tiefer als die Sechste Symphonie von Beethoven. Viel tiefer. Selbst Menschen, die mit Klassischer Musik wenig am Hut haben, runzeln hier vielleicht ein wenig die Stirn – so tief sitzen Konditionierungen, die uns Klassische Musik als heiligen Gral vorgaukeln. Lächerlich.
Das Archaische zielt auf Hörerlebnisse, die etwas Uraltes in uns wachrufen, bis hin zu der dünnen Grenze, wo Grenzen von Ich und Nicht-Ich etwas ins Schwimmen geraten können. Tiefe Trance, tiefe Empathie. Nicht zu versprachlichende Empfindungen. Welche Musik das ist, da trifft natürlich jeder seine eigene Wahl – solange Musik Seelennahrung bedeutet. Gestern war es „Dis“ von Jan Garbarek, abends, in meiner „elektrischen Höhle“. Gustav Mahler war für mich in jungen Jahren der Inbegriff des Archaischen.
Und dieses Archaische zielt auf Räume unseres Unterbewussten, ganz klar. Als Psychotherapeut arbeite ich mit Hypnose und Trance, mit veränderten Bewusstseinszuständen, die aus vertrauten Mustern rausführen. Meine Radionächte stimulieren ähnliche Prozesse. Hilfreich, bei solchen „Nachtwanderungen“, ist es, dass der Storyteller im Grunde ziemlich witzig ist, oder gewitzt – stell dir vor, dass alles würde bierernst inszeniert, calvinistisch, von der Kanzel, akademisch, schlaumeierisch, oder supercool – das wäre dann sehr leicht peinlich.
Martina: Ein Gedanke, der mich an deinen Moderationen immer fasziniert hat, war der, dass die Musik uns in andere Räume transportiert. Im Lauf der Zeit wurde mir klar, dass das ganz verschiedene Räume sein können, von real existierenden geographischen Landschaften, auch Stadtlandschaften (Underworld: mmm skyscraper i love you) bis zu Regionen, die individuelle und kollektive Erinnerungen hervorrufen (Trains of the Night) bis zu psychedelisch erfahrbaren Landschaften des Unterbewusstseins in Jon Hopkins Music for Psychedelic Therapy. Was bedeutet der Gedanke, dass Musik dich in andere Räume transportiert, für dich?
Michael: Diese „anderen Räume“ sind genau das, Martina, bestimmte Aussen- und Innenwelten. Nimm die Musik und das Cover der ersten Zusammenarbeit von Cluster & Eno! Oder die lyrics von Karl Hyde (s. oben), aus dem Underworld-Song „Hundred Weight Hammer“. Aus der „Drift Series 1“, für mich eine der grossen Schatzkisten der letzten 50 Jahre, wie sonst noch Keith Jarretts „Sun Bear Concerts“ oder Brian Enos „Music for Installations“. Was Innenwelten betrifft, da öffnet sich bei jedem Hörer ein anderer Ort. Und wenn sie „nur“ die Frequenz der Atmung senkt, besänftigt. Musik kann Initialzündung sein, Stimulanz, Raumöffner, Schutzschild, Teil eines survival kits, je nachdem. Der innere Prozess bleibt Privatsache. Zur richtigen Zeit gehört, begleitet dich eine bestimmte Klangwelt, kann dem Leben eine andere Richtung suggerieren, Empfindungen vertiefen, einer Trauer Form geben, einen Horizont öffnen (ich rede nicht von einem Bildungshorizont.). Mehr „Transport“ geht nicht.
Martina: Für mich, die ich wusste, dass es deine letzte Ausgabe der Klanghorizonte sein würde, wurde es melancholisch, als ich Abschiedsandeutungen wahrnahm: „by the time this cigarette is finished“ (Lambchop), „remember me“ (Laurie Anderson). Auch deshalb habe ich mich sehr über den ersten, energiegeladenen Track der letzten zwanzig Minuten gefreut, die Liveaufnahme der Allman Brothers Band at Fillmore East aus dem Jahr 1971. Das Zuhören hat alle Aufmerksamkeit gefordert und keinen Raum für Reflexionen zugelassen. Dann folgte die letzte Moderation, in der du unter anderem gesagt hast, dass das Gedicht von Ezra Pound (In the Station of the Metro) mit dem Blick auf Gesichter in der Menge nach der Interpretation deines wichtigsten Lehrers die Zyklen des Lebens veranschaulicht: Die Menschen in der U-Bahn sind verschieden alt. Im Hinblick auf 30 Jahre Klanghorizonte könnte ich noch eine Interpretation hinzufügen: Es ist auch dein eigenes Gesicht, das immer wieder in der Menge in einer Metro aufscheint, dein Gesicht, wie es sich im Lauf der Zeit verändert hat. Es kommt immer darauf an, von welchem Blickwinkel aus man etwas betrachtet und welchen Raumbegriff man anlegt, oder nicht?
Michael: Genau. Und ich wusste, die letzte Stunde, die letzten zwanzig Minuten werden emotional. Natürlich war diese letzte Nacht eine einzige Abschiedsvorstellung. Und was wollte ich ganz am Ende spielen? Wie sollte das Finale aussehen, klingen? Ich verabschiedete mich früh von der Vorstellung, „In My Life“ von The Beatles zu spielen, oder „Days“ von den Kinks. Nicht so dick auftragen. Obwohl – in einer allerletzten Sendung hast du Narrenfreiheit.
Die nächste Idee war, eine Wegstrecke aus der LP „Trains In The Night“ herzunehmen. Eine Reihe von Aufnahmen von Dampflokomotiven-Enthusiasten, die sich im Morgengrauen auf freier Wildbahn auf die Lauer legten, irgendwann früh in den Sechziger Jahren (während die Beatles in Hamburg Rock’n’Roll spielten), um die Geräusche der Lokomotiven und frühen Vögel einzufangen. Ein Evergreen unter meinen „Field Recordings“ in den dreissig Jahren. Eine Kreuzblende mit Enos „Discreet Music“ – letzte Worte, und dann, trara, ein herzerweichender spanischer Discoschlager, „Resistir“. Ich liebe den Song, den ich erstmals hörte am Ende von Pedro Almodovars herrlich trashigem, und wunderbar romantischen Film „Fessle mich!“
Aber schliesslich machte eine andere Kombi das Rennen. Ich wollte unbedingt irgendwann in der Nacht „In Memory of Elizabeth Reed“ spielen, von den Allman Brothers. Was für eine Liebeserklärung ohne Worte. Die fliegende Slide-Gitarre von Duane, Monate, bevor ein LKW eine Ladung Pfirsiche verlor und ihn unter sich begrub. Und dann, natürlich, Brian sings The Beatles, sozusagen, haha, aus „801 Live“. Die Zeit passte genau für zwanzig Minuten. Und das Intro von „Tomorrow Never Knows“, war exakt zwei Minuten lang, sehr rhythmisch, die ideale Grundierung für meinen letzten Text. Alles uptempo, ich wollte es nicht zu sentimental haben. Aber ein bisschen sentimental schon.
Mir war im Vorhinein klar, dass meine Stimme „brechen“ könnte, wenn mir bei meinen Abschiedsworten ein paar Dinge zu nah gehen, und das wollte ich nicht. Nicht, dass mich das geniert hätte, aber am Ende wollte ich eine geballte Ladung Lebensenergie, mit ein paar Elementen von „mystery“, Martina, à la „Twin Peaks“. Der Text von „Tomorrow Never Knows“, das ist mystery pur. Ich schrieb den letzten Text im Vorfeld haarklein auf, Satz für Satz. Und ich übte ihn sogar ein, was ich sonst nie mache. Ich beabsichtigte, das Tempo anzuziehen, und dabei eine lebendige Modulation der Stimme nicht zu vernachlässigen. Ausserdem ist es ein Trick: bei höherer Sprechgeschwindigkeit ist die Gefahr geringer, dass du dir ein paar Tränen aus den Augenwinkeln wischen musst.
Ich musste unter zwei Minuten bleiben, Harald Rehmann sollte darin vorkommen, meine lebenslange Liebe zu dem Album der Allman Brothers, der beste Lehrer, den ich je hatte, mein Freund Brian Whistler, etwas über den Hintergrund des Lennon/McCartney-Songs, die Ankündigung meines Nachfolgers, die zwei Gedichte von Pound und Shakespeare, und meine Londoner Undergroundreisen der letzten drei Jahrzehnte. Das ist eine Menge Stoff für zwei Minuten. Sowas improvisierst du nicht. Und, es hat geklappt. Dank Hans-Dieter Klinger und deinen Mitschneidekünsten, bleibt diese Nacht erhalten. Und das Finale liefert dieses Interview gleich mit. Wunderbare Fragen.
Martina: Erzähl‘ doch noch eine Geschichte.
Michael: Ich lese dir einfach etwas vor, was Ralph Molina von „Crazy Horse“ neulich erzählte. Er wurde gefragt, wie es gewesen war, bei der Produktion von Neil Youngs „Barn“. Auf dem Album ragen zwei Songs heraus, „Welcome Back“ und „Song of the Seasons“. Und Ralph sagte: „Wir spielen fast nie in Studios. Ich glaube, keiner von uns mag Studios. In der Scheune hatten wir einen guten Sound. Das einzige Problem war, dass es dort oben in den Bergen nachts kühl wurde. Und ich saß dort, wo über mir dieses riesige offene Fenster war, über dem eine Art Decke oder so hing. Und der Wind hat einfach ssssssh auf mich heruntergewirbelt. Es ist schwer zu spielen, wenn es kalt ist. Ich saß dann vor einer Heizung, das war mein Platz.“ Hätte ich dieses Interview gemacht, dieser O-Ton wäre garantiert in der Nacht zu hören gewesen. Da steckt viel drin. Und dann: „Ich habe mit Neil gesprochen, vielleicht vor einem Monat, und ich hatte endlich die Nerven, nach 50 verdammten Jahren, in denen ich mit ihm gespielt habe. Ich sagte: „Weißt du, wenn Elliot Roberts und David Briggs noch leben würden, würden sie wahrscheinlich das sagen, was ich dir jetzt sagen werde. Wenn man mit Crazy Horse spielt, muss man die Hymnen schreiben, die längeren Songs.‘ Da kann Neil glänzen. Er hat sich das zu Herzen genommen. „Welcome Back“ ist etwa neun Minuten lang, und alles leuchtet.“
Martina: Alles leuchtet.
Michael: Alles leuchtet – mir fallen dazu Boards of Canada ein: die beiden Brüder verweigern sich den Moden der Electronica ihrer Zeit. Sie lieben eine unstete, schwankende, verwackelte Textur, die an uralte Filmspulen erinnert, verstaubte Magnetbänder, abgelagertes Vinyl, alles anfällig für Verfall, Verzerrung – und Verzauberung. Da spielt stets das Unheimliche mit. Bei manchen Stücken von „Music has the right to children“ springen einen Erinnerungen geradezu an – jeder kennt gebleichte Fotosammlungen, das Driften durch Super-8-Filme der Kindheit, die gespeicherten Emotionen. Stranger Things…
Weisst du noch, damals.
Nein.
Weisst du noch.
War es schön, es war doch schön, manchmal, oder.
Ja ja, auch. Aber.
Aber.
Es war auch … anders.
Unheimlich.
Manchmal unheimlich schön.